21.05.2023 Die letzte Seite
200 Einträge pro Seite, bitte löschen sie alte Inhalte ... werde ich informiert als ich, wie üblich, am Abend das Tagebuch aufmache um die Erlebnisse des Tages aufzuschreiben. Der bewegende Besuch im Museum über die 12 Isonzo Schlachten im ersten Weltkrieg, herzerwärmende Erlebnisse in der Herberge. Der Bericht muss warten. 50. Etappe. Das erste Tagebuch voll. Nun habe ich ein Neues angeschafft. Es heißt: Von Pinnow nach Pyrgos. So heißt unser Projekt. Unbeschriebene Blätter. Zeit für eine neue Form.

20.05.2023
50. Etappe
Von Bovec nach Kobarid

Heute sind wir wieder nur Reisende. Haben den Fernwanderweg Alpe-Adria verlassen. „Vom Gletscher ans Meer“ und „Wandern im Garten Eden“ versprechen die Reiseprospekte. Wir haben nun eine kleine Ahnung, was es bedeutet, Benutzer dieser vorgefertigten Routen zu sein.
Als wir vor drei Tagen in Kranjska Gora aufbrachen, um den Vršič- Pass zu überqueren, dauerte es nicht lange, da tauchte vor uns ein schwatzendes Damenquartett Ü40 auf. Auf Wegbreite aufgefächert, bis an die Halskrause ausgerüstet mit allem, was der örtliche Outdoorladen so hergibt. Treckingstöcke, Wanderstiefel, Rucksäcke mit integrierter Trinkflasche, Funktionskleidung, Stirnbänder, alles niegelnagelneu.
Wir stiefelten schweigend hinterher und beobachteten das Schauspiel. Von hinten. Fröhlich, lärmend, bunt. Nicht schlecht, aber die neueste Mode ist nicht von Vorteil. Eng anliegende Leggings in Kreischfarbe. Mir spukt das Wort „Presswurst“ durch den Kopf. Böser Gedanke.
Irgendwann biegen wir ab. Nehmen eine unserer kräftesparenden Abkürzungen. Wir sind mittlerweile Meister im Finden dieser Marscherleichterungen.
Am Abend, wir sitzen bereits beim zweiten Bier auf dem Hof der Pretners, kommt eben diese Wandertruppe angekeucht. An die hatte ich gar nicht mehr gedacht. Hochrot, völlig verschwitzt und längst nicht so gesprächig wie vor acht Stunden.
Beim Frühstück trifft man sich ein drittes Mal und eine Stunde später wiederholt sich die Szene vom Tag davor. Sie, schwatzend vor uns, irgendwann verschwunden. Wir trinken bereits unser zweites Bier in Bovec, da kommen sie auf den Marktplatz geschnauft. Hochrot, völlig verschwitzt und wieder längst nicht so gesprächig wie vor acht Stunden. Täglich grüßt das Murmeltier!
So würde es wahrscheinlich weitergehen. Immer dieselben Leute an den Stationen des Trails. So richtig angenehm ist mir das nicht. Außerdem ist es mittlerweile ordentlich voll geworden. Immer müssen wir zur Seite treten, warten bis wieder fünf Wanderer und ein Hund den schmalen Pfad passiert haben. Ich frage mich, nach welchem Prinzip meistens wir die Ausweichenden sind.
Aber es gibt auch gute Sachen an diesen Treckkingrouten. Wir haben einen freundlichen, originellen Menschen kennengelernt. In Kranjska Gora haben wir die ersten Worte gewechselt, in Trenta zusammen gefrühstückt. Lars, Baujahr 1974, kommt aus Naumburg. Hat Ingenieur für Kfz-Wesen in Zwickau studiert. Vor neun Jahren ein kleines Café in der Altstadt aufgemacht. Ein Einmann-Betrieb. Er backt Kuchen und Torten selbst. Es läuft nicht gut. Mehr als ein Tausender im Monat kommt nicht rum.
Wir finden schnell Anknüpfungspunkte. Unser MZ-Motorrad, das Leben in Sachsen-Anhalt. Er ist noch nie gewandert. War früher mit seinen Eltern in Tschechien. Sie haben aber immer nur Heidelbeeren gesammelt. Er möchte noch einmal was ganz Neues probieren und hofft auf Inspiration unterwegs.
Gestern Abend in Bovec haben wir auf Lars gewartet. Immer wieder aus dem Küchenfenster unseres Hostels über den Platz geschaut. Wir wissen, dass wir in der selben Herberge schlafen. Auch er nimmt immer die preiswerteste.
Ob ihm nichts passiert ist? Er ist doch ungeübt und die Etappe nicht ganz ohne. Wir hätten uns seine Telefonnummer geben lassen sollen. Beinahe machen wir uns Vorwürfe. Es ist schon fast dunkel, da sehen wir die zwei Meter große Gestalt mit Schlapphut über den Platz zum Hoteleingang streben. Er ist angekommen. Alles lief gut. Unterwegs hat er auf einem Felsen für zwei Stunden ein Nickerchen gehalten. Wir haben für ihn mitgekocht. Er kommt genau richtig zum Essen.
Heute ist es viel ruhiger auf unserem Weg. Wenige Wanderer. Das Kreischen der Menschen in den Raftingbooten auf der Soča dringt nur leise an unser Ohr. Die Alpe-Adria Trail-Wanderer sind abgezweigt, gehen noch einmal auf über 1300 Meter in die Höhe. Wir bleiben im Tal. Morgen machen wir einen Ruhetag in Kobarid. Die letzten drei Etappen waren wunderschön, aber etwas kräftezehrend. Hier gibt es ein Museum, welches sich mit den Geschehnissen des 1. Weltkriegs in diesem Tal beschäftigen. Zeit für geistige Arbeit, für Verarbeitung des Erlebten, für ein Innehalten.

19.05.2023
49. Etappe
Von Trenta nach Bovec

Letzte Nacht konnte ich nicht schlafen vor Glück. Immer wieder wache ich auf. Lausche auf die Geräusche der Nacht. Den Wind in den Bäumen, ein Bächlein murmelt beständig vor sich hin. Ich drehe mich auf die andere Seite, kuschel mich ein Stück tiefer in meinen warmen Daunenschlafsack. Ein Lächeln durchströmt mich. Genau davon habe ich geträumt.
Wir liegen eng beieinander in einem winzigen Häuschen mit spitzem Dach, einer Finnhütte gleich. Kaum größer als ein Zelt. Gerade unser Bett passt hinein und links und rechts ein kleines Nachttischchen. Wir schlafen bei offener Tür. Dunkelheit, Kühle, mittlerweile schwarz gewordenes Grün im Überfluss, nächtliche Natur, geheimnisvolles Geschehen umgibt uns. Es duftet nach Holz und Firnis. Alles ist ganz neu. Wir sind die ersten Gäste, die hier schlafen dürfen.
Gestern am frühen Abend sind wir bei den Pretners in Trenta angekommen. Wir werden herzlich empfangen, bekommen ein Begrüßungsgetränk, den Schlüssel zu unserem Häuschen, nehmen unser Paket in Empfang. Darin unser Zelt, Roberts kurze Hose, ein Kompass und ein Kamm. Lauter Dinge, die wir bis hierher nicht brauchten oder schlicht vergessen hatten. Die Familie ist Verwandtschaft von Matthias und Alenka, guten Bekannten aus Schwerin. Sie haben uns diesen Anlaufpunkt verschafft. Als Postadresse, als kleines Paradies für einige Stunden.
Die Wirtsleute sind beschäftigt, sie betreiben einen Biohof mit Ferienwohnungen. Müssen sich um die Landwirtschaft kümmern, um die 50 Schafe, Essen kochen für die Gäste, es gibt noch einen Termin in Bled, auf der anderen Seite des Vršič-Passes.
In dicken Pullovern sitzen wir draußen bis zum Einbruch der Dunkelheit, lassen die Eindrücke des Tages Revue passieren, genießen den erhabenen Blick über die slowenische Bergwelt. Ein magischer Ort.
Stanka, der Wirbelwind, empfängt uns beim Frühstück. Die Herrin des Hauses weist in die Kaffeemaschine ein, kocht wachsweiche Eier, bestückt unermüdlich das Buffet mit selbstgemachten Marmeladen und hauseigenem Schafskäse. Gibt Wanderempfehlungen, macht Routenvorschläge, informiert über Schneehöhe in den höheren Lagen, weiß über slowenischen Wein Bescheid, kennt die Bärenproblematik am eigenen Leib, scannt die Personalausweise, schreibt Rechnungen, kassiert ab. Erstklassig, vorzüglich, rundum gut.
Das Beste zum Schluss. Wir sind eingeladen. Ich bin sprachlos. „Warum Robert, warum bekommen wir soviel geschenkt?“
Wir müssen unbedingt wieder kommen. Aber das wusste ich ja schon vorher.
Heute wandern/reisen wir nach Bovec. Zwanzig unverschämt spannende Kilometer entlang des schönsten europäischen Gebirgsflusses. Immer wieder spreche ich innerlich Empfehlungen aus. „Pfeffi, Kerstin, Ihr wollt doch in die Alpen Ende Juni. Fahrt hierher! Ich stelle Euch Touren zusammen. Martin, Christine, Ihr geht doch auch gerne in die Berge. Es würde Euch bestimmt gut gefallen.“
Ich habe mein Herz verloren an diesen Ort.

18.05.2023
48. Etappe
Von Kranjska Gora nach Trenta

Nun sind wir beinahe acht Wochen unterwegs und immer noch Lernende in Sachen unterwegs sein.
Während Robert in aller Regel nach unserer Ankunft ein Nickerchen hält, bin ich online. Suche, schnüffele, erkunde virtuell die Umgebung. Wenn er nach einem Stündchen wieder zu sich kommt, beginnt die Tourenplanung. Ich auf 180, er im Halbschlaf.
„Hähnchen, da gibt es eine tolle Aussicht und dort eine tiefe Klamm und weiter hinten entspringt auf abenteuerliche Weise ein Fluss und sieh nur diesen Gipfel da hinten.“ Da müssen wir hin und dort vorbei und da auch noch. Wie eine Biene möchte ich schwirren von Blüte zu Blüte. Von Aussicht zu Wasserfall von Quelle zur Bergspitze. Immerzu habe ich das Gefühl, etwas zu verpassen. An der wirklich allerschönsten Stelle um wenige Meter vorbeizuschrammen. Wäre man vorhin geradeaus gegangen, dann wäre man jetzt… entspannt finde ich die Situation selber nicht.
Robert erduldet, bleibt stoisch, sitzt aus. Heute hat er mir eine Antwort gegeben. Ein Kästchen aufgemacht, in welches ich mich nun beruhigt einkuscheln kann.
„Sieh nur Huhni“, erklärt er mir wenige Minuten unterhalb des Vršič-Passes, „es gibt Bergsteiger. Die suchen sich einen Gipfel aus. Gehen hoch und wieder runter und die Mission ist erfüllt. Dann gibt es Wanderer. Die kommen am Wochenende oder in ihrem Urlaub, wählen eine abwechslungsreiche Tour im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Am besten eine Rundtour. Manchmal gönnen sie sich ein paar Etappen eines angepriesenen Fernwanderweges. Wir, Huhni, wir sind Reisende. Zu Fuß unterwegs. Wir kommen von A und wollen nach B. Unser Fokus liegt auf dem Weg und allem was uns auf diesem begegnet und nicht auf touristischen Höhepunkten entlang der Strecke.“ Ich denke eine Weile darüber nach. Die Idee gefällt mir. Ich gefalle mir in dieser Idee. „Ich bin eine Reisende“, denke ich feierlich.
Wie der Zufall es will, ist unsere heutige Etappe Reise und Wanderung in einem. Eine echte Bergtour. 900 Meter hinauf, 1050 wieder herunter. Der Aufstieg über steinigen Eselspfad bis über die Baumgrenze, inklusive Abenteuer. Der Weg verschwindet im rauschenden Gebirgsbach. Also Schuhe aus, Hosen hoch und ab durchs steinige Bachbett. Das Wasser knietief und nur wenig über dem Gefrierpunkt. Das zwiebelt ganz ordentlich und reinfallen möchte ich jetzt hier auch nicht. Geschafft! Füße abtrocknen, weiter geht es. Vier Stunden arbeitet der Kreislauf auf Hochtouren. Die Belohnung - der grandiose Ausblick auf die Berglandschaft am Pass.
Immer mal wieder laufen wir für die ein oder andere Kehre auf der Passstraße. Pulks von Motorradfahrern mit bis zu zwei Kameras auf dem Helm. Radfahrer mit hochroten Gesichtern, Wohnmobilisten, putzige Oldtimer auf Ausfahrt lärmen dem Pass entgegen. Auf 50 Kurven, teilweise noch mit Kopfsteinpflaster belegt. Die Geschichte dieser heutigen Freizeittrasse ist mit Blut geschrieben. Gebaut wurde sie 1915/16 als Militärstraße für Österreich-Ungarn ins Isonzo/Soča-Tal. Unter unmenschlichen Bedingungen von russischen Kriegsgefangenen gebaut. Über 400 von ihnen kamen allein bei einem Lawinenabgang im März 1916 ums Leben. Ob die Konsumenten von heute wissen, zu welchem Preis jeder Pflasterstein hier verlegt wurde?
Der Abstieg in abenteuerlichen, halsbrecherischen Serpentinen. Der geröllige Weg selten breiter als ein Handtuch. Ein tosender Wasserlauf zu unserer Rechten. Zu unserer Linken türmt sich eine zerklüftete Felswand. 1000 Meter auf 5 Kilometer. Am Ende sind die Knie weich. Höchste Aufmerksamkeit ist angesagt. Die meisten Unfälle passieren kurz vor dem Ziel. Zur Krönung noch ein paar Kilometer auf einem wurzeligen Waldweg entlang der blau grünen Soca. Acht Stunden Gehzeit. Acht Stunden Wanderung, für acht Stunden Reisende.

17.05.2023
47. Etappe
Von Tarvisio nach Kranjska Gora

Wir stehen auf einer schmalen Brücke und schauen fasziniert in die felsige Klamm. Auf dem Grund, 100 Meter unter uns, schäumt und braust ein wilder Gebirgsbach. Ganz entspannt ruhen meine Hände nicht auf dem Geländer. Etwas schwitzig und auch verkrampft. Ein leichter Schwindel vernebelt mein Gehirn. Der Rausch der Tiefe. In Italien stürzen ja bekanntlich dauernd Brücken ein. Das drei Meter breite Viadukt, auf dem wir stehen, ist Teil des 1965 stillgelegten Eisenweges zwischen Jessenice und Tarvisio. Im Jahr 1870 fuhr hier der erste Zug. Wie, um alles in der Welt, haben sie Ende des vorletzten Jahrhunderts diese Brücke geschlagen? Mit den damaligen Mitteln und Werkzeugen? Mir fehlt es an Phantasie.
In leichtem Nieselregen folgen wir der ehemaligen Kronprinz-Rudolf-Bahn. Unser Ziel: Kranjska Gora. Wie oft haben wir in unserem Navigationssystem in den letzten Wochen diesen Ort eingegeben? Uns dorthin gesehnt. Uns nicht vorstellen können, je dort anzukommen. Zu Fuß. Nun sind wir da.
Wir haben die beste Herberge der gesamten Reise gefunden. Preiswert. Ein einfaches Zimmer. Ein Gemeinschaftsraum mit Kachelofen und gut ausgestatteter Küche. Aber das ist nicht neu, das hatten wir schon. Neu, bisher einzigartig und wunderbar: Der Raum ist voller freundlicher und hilfsbereiter Menschen zwischen 8 und 80 Jahren. Die einen kochen, die anderen spielen Karten, ein Fußballspiel läuft im Hintergrund. Wir kriegen den Herd nicht an – uns wird ungefragt geholfen. Robert sucht Senf – man sucht gemeinsam im großen Kühlschrank und wird fündig. Vertraut slawische Worte im Ohr. Der Sanitärtrakt duftet nach Wofasept. Und ab morgen die Tour, auf die ich mich freute, noch bevor die Idee der großen Reise überhaupt geboren wurde. Über den Vršič-Pass durch das Tal der Soča in Richtung Adria. Zweimal waren wir schon hier. Haben die Gegend erkundet und als Ort der Sehnsucht definiert.
Fast zwei Drittel der Fläche Sloweniens sind von Wald bedeckt. Neben einem Nationalpark gibt es drei Regionalparks, fast 100 Naturschutzgebiete und geschützte Landschaftsparks sowie mehr als 1000 Naturdenkmäler. Mehr als die Hälfte der Landfläche steht unter Naturschutz. Slowenien, das nachhaltige Land im Herzen Europas? Womit auch immer geworben wird. Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen. „Wehe Robert, Du hetzt mich hier durch.“
Ab morgen müssen wir ein neues Ziel definieren. Wahrscheinlich irgendwas an der Adria. „Eine konkrete Idee haben wir schon! Später mehr!“ orakelt Robert. Ich sehe das anders. Das neue Ziel wird in einer ausschweifenden Gesprächsrunde im Konsens-Verfahren festgelegt. Alles ist offen.
16.05.2023 Urlaub in Bella Italia!
Gestern sind wir nach Camporosso gegangen. Ein 560-Seelenörtchen oberhalb von Tarvisio. Unsere Höhe heute: 820 Meter über Null. Am Tag davor: 520 Meter. Da sind wir dem Himmel ja schon wieder ein kleines Stückchen näher und tendenziell auf dem richtigen Weg über die
Friaul-Julischen Alpen, wenn auch deutlich nach Westen abgedriftet.
Wie wir hier gelandet sind, können wir so genau gar nicht mehr sagen. Das ist das Schöne, wenn der Weg erst beim Gehen entsteht. Italien hatten wir jedenfalls definitiv nicht auf dem Plan.
Im Prinzip ist es immer wieder die selbe Litanei. Unsere Gebirgslitanei.
Der Wurzenpass, dieser Schuft, war diesmal Schuld. Da müssen wir drüber. Der Fußweg verschneit und die Hütten noch geschlossen. Der Fahrweg kurvig, eng und stark befahren. Einen Bus gibt es nicht. Wir müssen also drumherum. Entweder im Osten mit der Eisenbahn durch den Karawankentunnel nach Slowenien oder im Westen in Richtung Italien. Wir überlegen und planen hin und her. Studieren den Fahrplan, die Unterkünfte und die Länge der Strecke. Das Los fällt auf Italien. Die Unterkunft ist preiswerter, der Weg vielversprechender. Er führt uns entlang der alten Pontafelbahn, die einst Villach mit Udine verband. Die alte Strecke von 1879 verlief angelehnt an die Fella, den Fluß im Kanaltal durch zahlreiche kleinere und mittlere (bis 600 Meter) Tunnel und Galerien. Bedingt durch Erdbeben und Unwetter war die Strecke öfter im Betrieb bedroht und man entschloss sich, eine neue Pontebbana zu errichten, die großteils im Berg verläuft. Im Jahr 2000 wurde die alte Strecke geschlossen und für wenige Wanderer und viele Radfahrer umgebaut. Das skurrile Moment an unserer Wanderung sind die alten Bahnhofsgebäude entlang der Bahnstrecke, die man halb leer geräumt sich selbst überlassen hat. Verfall, Untergang, Vergänglichkeit – faszinierend morbide.
Schön ist es in Italien zu sein. Aus dem zünftigen „Griaß di“ ist das schnurrend gesangliche „buongiorno“ geworden.
Das Zischen der großen Espressomaschinen im Café, das Klappern der Tassen, der Duft und der Geschmack des kleinen, starken Espresso. Einzigartig.
Zwei Wünsche habe ich heute. Erstens möchte ich im Sonnenuntergang auf einem Südbalkon sitzen und einen Campari schlürfen. Echte Sommerfrische. Zweitens wünsche ich mir einen total verregneten Dienstag. Da bleibe ich den ganzen Tag im Bett. Ich bin schließlich im Urlaub. Beides geht in Erfüllung. Unsere Wohnung hat tatsächlich einen Südbalkon und über Nacht schaufelt das Italientief munter Wassermassen in die Region. Ich bleibe liegen und Robert findet wieder einmal Zeit für seine:
Kleine Robertsche Abschweifung 9
Jeder kennt diese lästigen Geschwindigkeitsanzeiger an Ortseingängen, die mit Stundenkilometeranzeige, grünem Grinsegesicht und roter, weinerlicher Fratze dem harmlosen Autofahrer ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen bereiten sollen (haha, bei mir zieht dieser Quatsch nicht). Wenn ich nach Pinnow zum Flugplatz fahre, gebe ich vor dieser seltsamen Anzeige nochmal richtig Gas, damit ich mich an der grellroten Heulgrimasse erfreuen kann. Geblitzt wird dort nicht und ich mache es nur, wenn Martina nicht dabei ist. Es ist eine kleine Flause von mir und sie hätte kein Verständnis.
Diese Geräte sind – was nicht jeder weiß - europaweit verbreitet. Wir wanderten durch Tschechien und Österreich und auch dort sind sie präsent. Was wir nicht wussten: Offenbar messen sie alles, egal ob Blechkarosse, Mensch oder Igel auf nächtlichem Streifzug. Vielleicht ja sogar das Gras beim Wachsen. Auf einsamer, österreichischer Landstraße näherten wir uns einem dieser Verkehrserzieher. Die Anzeige registrierte konstant fünf Kilometer pro Stunde. Weit und breit kein Auto zu sehen. Messen die etwa uns? Nun wollte ich es wissen: Ich setzte zu meinem berühmt-berüchtigten Sprint an, Schnellkraft aus der Wade bis in den letzten Muskel des Oberschenkels, der Rücken bog sich unter der unglaublichen Kraftanstrengung und harpunengleich schoss ich los in Richtung Messfühler oberhalb der noch immer grünen, dümmlich grinsenden Visage. Aus den 5 km/h wurden 8, wurden 10 km/h. Einzig mein Rucksack im Nacken hinderte mich, das grimmige Rotgesicht zu sehen und dadurch unglaublichen Triumph zu erfahren. Die wilde Aktion brachte Martina auf eine Idee. Und zwar den Schweriner Blitzerlauf! Wie langweilig sind bei uns der Drei-Seen-Lauf, Fünf-Seen-Lauf oder gar der Sieben-Seen-Lauf. Der zukünftige Blitzerlauf wird in einer Schweriner Dreißigerzone vor einem aktiven Verkehrsblitzer stattfinden. Die flinkfüßigen Sportskanonen versammeln sich 100 Meter vor dem Blitzgerät und versuchen, es per Sprint auszulösen. Jeder durchschnittliche 100-Meter-Läufer kann das schaffen. Weltrekordläufer – wir haben es mühselig ausgerechnet – kommen auf ca. 37 km/h. Da werden es doch die Schweriner Lokalgrößen auf die nötigen 31 km/h schaffen. Und bei dieser Art Blitzerlauf würde auch die sonst humorlose Ortspolizei mitspielen und die entsprechenden Strafbescheide ausstellen. Eine Ehre für jeden Teilnehmer.
Ende der Abschweifung.

15.05.2023
46. Etappe
Von Villach nach Tarvisio

Villach haben wir erreicht und Österreich liegt damit fast hinter uns.
Die Stadt mit 60.000 Einwohnern liegt in Kärnten, ganz im Süden des Landes, istwichtiger Verkehrsknotenpunkt und war die letzten Wochen unser anvisiertes Zwischenziel. Nun sind wir angekommen… schon.
Den Abschiedsabend haben wir uns geschenkt. Kein Gaststättenbesuch, keine Flaschengärung. Kein Grund für Sentimentalität an den scheinbar willkürlich, schwer nachvollziehbar gezogenen, sich ständig verändernden, fadendünnen Strichen auf Landkarten. Grenzen. Grenzen? Wir sind Europäer. Und nicht nur im Bezug auf niedrigpreisige, alkoholische Getränke.
So sitzen wir nun befremdet am Grenzübergang Thörl-Goggau auf einer Bank und mümmeln betreten unser Frühstücksbrot. Mit einem Bein in Österreich mit dem anderen in Italien. Die Kontrollhäuschen verwaist, ihre verspiegelten Fensterscheiben schon lange nicht mehr geputzt. Wechselstuben gammeln vor sich hin. Der Friede ist trügerisch.
Die Grenze ist noch da. Das Ungeheuer schläft nur. Wie lange würde es dauern, es zu wecken? Die Grenze zu verschließen und unpassierbar zu machen? Zwei Tage? Wir erinnern uns an die Flüchtlingskrise 2015, die die Tragfähigkeit der EU-Verträge, ihre programmatische Integrationskraft und generell die innereuropäische Solidarität in Frage gestellt hat.
„Robert“, nuschele ich mit Käsebrötchen im Mund, „hätten wir vor 120 Jahren diese, unsere Reise gemacht, dann hätten wir von Joachimsthal kurz hinter dem Oberwiesenthaler Pass bis nach Istrien an der Adria keine einzige Grenze passiert. Kann das sein?“ Er überlegt. Betrachtet innerlich die Karte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie.
„Recht hast Du Huhni“, sagt er und noch irgendetwas von Amtssprache deutsch. Vielsprachig, multikulturell, bunt ging es zu. Wir müssen es aber auch nicht glorifizieren. Das dicke Ende kommt noch. Zwei Tagesmärsche noch und wir sind, aus historischer Sicht, mittendrin im grausamen Gebirgskrieg zwischen Österreich-Ungarn und Italien von 1915 bis 1918.
Alles in allem kein Grund also für euphorische oder sentimentale Abschiedszeremonien an Grenzen.
Rückschau halten wir trotzdem.
Österreich, das bedeutet zwei Drittel Alpen. Und Land macht Leute. Die Alpen haben wir nun verstanden. Jedenfalls die Ostalpen. Das ganze oberflächliche Halbwissen aus ca. 25 Spritztouren in irgendein Alpenmassiv inklusive Hüttentour, Gipfelsturm und Klettersteig, konnten wir ergänzen zu einem Ganzen. Jetzt wissen wir Bescheid. Wir haben uns das erlaufen und am eigenen Leib erfahren.
Als wir vor dem Dachstein standen, haben wir gedacht, wenn wir da drüber sind, haben wir es geschafft. Pustekuchen. Clever, wie wir uns fühlten, haben wir das Massiv umfahren und standen vor der nächsten schneebedeckten, felsigen, trutzigen Wand.
Der Dachstein gehört zu den Nordalpen. Ein 500 Kilometer breiter Höhenzug in Ost-West-Ausrichtung, der dem eigentlichen Alpenhauptkamm vorgelagert ist. Was sich nun vor uns auftürmte auf der anderen Seite des breiten, grünen Tal der Enns, war der Alpenhauptkamm. Damit hatten wir nicht gerechnet. Ganz ehrlich. Umfahren ging nicht, also darüber. Der Tauernpass, der Katschberger Pass. Dazwischen die Passage des „sibirischen“ Hochplateaus, den Lungau. Und nun, nach dem zweiten Frühling im Drautal stehen wir in Kürze vor der dritten Herausforderung. Vor uns die Südalpen. Das Spiegelbild seines nördlichen Pendant.
Vom poetischen Namen Friaul-Julische Alpen sollten wir uns nicht einlullen lassen. Es wird noch einmal auf über 1600 Meter hoch gehen. Aber dann geht’s nur noch bergab bis zur Adria.
Heute war ein schöner Wandertag. Die Jacke und die Regenjacke im Rucksack. Sind wir erst einmal über den Berg, kommt kurzärmelig und dann gleich schwitz. Warum sollte nach dem kältesten April, dem nassesten Mai nicht der heißeste Sommer kommen? Wandern im Extrembereich. Wir bleiben optimistisch, wir bekommen das schon hin. Schließlich haben wir (zwei) Köpfchen.

14.05.2023
45. Etappe
Von Feistritz an der Drau nach Villach

Sonntag - häng' den Pelz in den Spind
Sonntag - wärmer weht heut' der Wind
Alle Blumen blüh'n und es ist Frühling da
Und rund um uns ist es nun so weit
Schau' nur, es blüht auf jeder Wiese
Es blüht auf jedem Kleid
Du siehst: Es ist Zeit
...singt uns Manfred Krug vor, während wir noch im warmen Bett liegen. Wie gut, dass es Spotify gibt.
Ja, heute ist Sonntag. Und es regnet mal wieder Bindfäden. Unwillkürlich ziehe ich die Bettdecke noch ein Stückchen mehr über meine Nasenspitze.
„Hähni“, schnurre ich leise, „lass uns mal alle Sonntage auf unserer Reise aufzählen.“ Ich will nicht raus aus dem Bett und nicht raus in den Regen. Der innere Schweinehund setzt auf Verzögerungsstrategien.
„Der erste Sonntag war der in Leipzig“, erinnere ich mich. „Die Familie hat sich getroffen. Die Oma Birgit, Matze, der Jakob kam extra aus Schwerin. So einen schönen Tag hatten wir und abends bei Conny und Wolfgang ist dann das Bett zusammengekracht.“ Robert schmunzelt. Er erinnert sich. Den zweiten Sonntag verbrachten wir in Oberwiesenthal. Es war Ostern und alles hatte zu.
Der dritte Sonntag war ein wunderbar sonniger Frühlingstag. Wir wanderten nach Konstantinovy Lázně. Draußen haben wir gesessen, in einem Biergarten. Abends waren wir Essen und wurden von einem noblen tschechischen Kellner bedient. „Gänsebraten habe ich gegessen“, ruft Robert. Wundert mich nicht, dass er das noch weiß. Am Sonntag Nummer vier feierten wir Abschied von Tschechien. Im Schlossrestaurant von Železná Ruda. „Robert, da hast Du Dir 500g Bratkartoffen bestellt“, erinnere ich meinen lieben Vielfraß. Er streitet alles ab.
Am Sonntag Nr.5 sind wir gerade nach Österreich gekommen. Wir gingen durch hügeliges, baumloses Land und ganz, ganz hinten am Horizont konnte man die schneebedeckten Gipfel der Alpen erkennen. Unendlich weit weg erschienen sie uns damals.
Neben mir im Bett höre ich ein kleines Schnarchen. Das darf doch nicht wahr sein. Muss man hier immer alles alleine machen. „Robert, nicht schlafen, hilf mir lieber mal, es sind doch auch Deine Erinnerungen.“
Sonntag Nr.6 scheint wie gestern. In Radstadt waren wir da. Haben schon mittags in der Sonne gesessen, Bier getrunken und das Treiben der Kommunionsgesellschaft beobachtet. Es kommt uns vor, als wäre es gestern gewesen. Die Zeit nimmt wieder Fahrt auf, beginnt zu rasen.
Heute, am Sonntag Nummer 7, gehen wir nach Villach. Vorher müssen wir aber erst mal raus aus den Federn. Wir sammeln die Kräfte, packen routiniert zusammen und keine halbe Stunde später sitzen wir im Hotel „Zentral“ um die Ecke bei einem Morgenkaffee. Die Kurve von unserer Herberge bis hierher haben wir laut Navi in Rekordgeschwindigkeit von 5,3 km/h gekratzt.
Im Regen machen wir uns auf den Weg, im Regen kommen wir an. Nach einer Rekordzeit von etwas über vier Stunden erreichen wir das 20 Kilometer entfernte Villach. Keine Pause, keine Rast und immer noch kein Frühstück. Es hat ununterbrochen geregnet und kein trockenes Plätzchen am Wegesrand lud zum Verweilen ein. Nicht gerade ein klassischer Sonntagsspaziergang. Schön war es trotzdem. Still, einsam, stimmungsvoll. Das ganze schöne Tal der Drau, die wolkenverhangenen Berge, die kräftig grünen Wiesen – alles nur für uns allein. Sehr exlusiv.
Ich habe ein Geschenk bekommen. Ich weiß nicht von wem und auch nicht warum. Was auch immer ich mir betrachte: Menschen, Dinge, Begebenheiten oder Umstände. Ich kann in allem das Gute, das Schöne, das Besondere sehen. Völlig ohne Anstrengung und ohne rosarote Brille. Ein Satz von Christian Morgenstern kommt mir in den Sinn: „Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden.“ Vielleicht hat es ja etwas damit zu tun.


13.05.2023
44. Etappe
Von Spittal an der Drau nach Feistritz an der Drau

Kleine Robertsche Abschweifung 8
Die wahrhaftigen Europäer sind wir!
In unserer Nachbarschaft und im Freundeskreis haben wir wahrlich genug Weinkenner und Freunde des Rebensaftes. Der Gourmet um die Ecke schwört auf den kräftigen Franzosen, die Freunde in der Schelfstadt auf den leichten Italiener und das Lehrerpaar vom Platz der Jugend, die auf Gran Canaria gelebt und gelehrt haben, auf den soliden Spanier.
Wir beide sind da aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Jeder Nationalismus ist uns völlig fremd, Kleinstaaterei sowieso. Das Herz schlägt europäisch, was sage ich… weltoffen, very international.
Wir verbringen zwei Tage in einem kleinen österreichischem Ort am Ende eines Tales. Wir machen uns, wie gewöhnlich nach unserer Ankunft, auf die Suche nach Nahrung und uns angemessenen Getränken. Anderthalb Kilometer das Tal runter gibt es einen ADEG, so heißt hier der Konsum. Wir wählen Lebensmittel aus, orten das Weinregal.
Rasch werden wir unserer Einstellung gemäß fündig: Wir suchen preiswerten Wein und finden europäischen Wein. Wir lesen: „Der rote Musketier. Wein aus Europa“ und „Der weiße Musketier. Wein aus Europa“. Beide trocken.
Wir schlagen zu. Es gibt kein Halten. Dunkel erinnere ich mich an den Glykol-Skandal aus den achtziger Jahren. Österreichische Winzer peppten Billigwein mit Frostschutzmittel auf und verkauften die Brühe als Eiswein und Spätlese. Kann uns bei unserem Europawein nicht passieren, denn der Frostschutz ist sicher teurer als unser Gesamtprodukt: ganze 2,99 Euro für die 2-Liter-Eule in der Plastikflasche mit Schraubverschluss. Wir müssen uns bücken. Die Plörre steht natürlich im untersten Regal.
Im Quartier angekommen, schmeiße ich die Weißweinbombe in den Tiefkühler. Aber schon nach 10 Minuten machen wir uns an die Verkostung. Beim Roten Musketier verzichten wir auf das Dekantieren. Muss eben auch mal ohne gehen. Wir schnappen unsere Plastiktrinkbecher (rosa und blau) und gießen ein: Für Martina den Roten, für mich den Weißen. Ich lasse den Rebsaft über meinen Gaumen rinnen und spüre ein sanftes Prickeln im Abgang. Ich fülle nach und lasse den Wein unter der Zunge rotieren und schwupps, ist er wieder weg. Nicht so schlimm, es ist ja genügend da.
Martina lässt ihren Roten kreisen, schnalzt mit Lippen und Zunge und meint, er wäre ein wenig pelzig in der Mittelphase. Aber doch süffig, vielleicht etwas frech und insgesamt für ihren Geschmack zu unartig.
„Krachsauer“, schiebt sie nach. Aber so mag sie es.
Ich stelle mir vor, wie Tanklaster und Kesselwagen aus ganz Europa nach Neuendorf in Österreich fahren und ihre schaurige Fracht abpumpen. Abgefüllt ebendort und eine Registriernummer, nichts anderes steht auf der Plastikflasche. Ein „Weinkenner“ überwacht die zornige Mischung, lässt
50 kg Zucker in den Riesenmixer rinnen, 10 kg Aromastoffe und noch 200 Liter vom süßen Bulgarischen, weil der ja weg muss. Egal, wir trinken auf Europa und morgen gehen wir in den nächsten Supermarkt und suchen – na was wohl – nicht den Europawein – sondern den Weltwein.
Abschweifung Ende
Das Wetter heiter bis wolkig. Die Stimmung ausschließlich heiter, so wandern wir die 20 Kilometer von Spittal an der Drau nach Feistritz an der Drau. Und wie könnte es anders sein – immer entlang des Flusses gleichen Namens. Sie ist eine Sie und ein schöner, kräftiger Fluss, welchem wir heute die Ehre haben zu folgen. Ihre Reise hat sie begonnen im italienischen Südtirol, fließt dann durch Osttirol, Kärnten (hier begleiten wir sie ein wenig), Slowenien, Kroatien und Ungarn. Sie mündet schließlich in…? Und ganz zum Schluss ergießt sich alles ins...?
„Das ist ein Rätsel, Robert. Hast Du aufgepasst in Geographie?“
Die Drau entwässert Osttirol und fast ganz Kärnten. Sie stellt für diese beiden Regionen die wichtigste Lebensader dar. In ihrem Oberlauf ist der Fluss über weite Strecken naturbelassen. Doch schon bald wird sie zum Schutz vor ihrem eigenen Hochwasser in ein enges Mauerbett gezwungen. Auch wir laufen heute auf einem Deich. Es fühlt sich kurz an wie an der Elbe, wären nicht die schneebedeckten Berge. Der morgendliche Blick aufs Höhenprofil inspirierte mich zu diesem Vergleich. Da es am Oberlauf der Drau keine belastenden Industriebetriebe gibt, hat sie durchgehend die Gewässergüteklasse 1. Es gibt vier Gewässergüteklassen und drei Unterklassen, erfahre ich im Internet. Klasse 1 ist natürlich die Auszeichnung nach oben. „Diese Güteklasse weisen nur Quellbäche und sehr gering belastete Oberläufe von Fließgewässern in von Menschen unbeeinträchtigten Gebieten der Alpen und der Mittelgebirge auf“, erfahre ich auf wasser-wissen.de Die Drau ist eine Streberin.
Die unterste Stufe bedeutet: völlig mit Abwasser verunreinigte Gewässerabschnitte. „Das ganze Gewässer erscheint durch die Massenentwicklung des „Abwasserpilzes“ und von Schwefelbakterien weiß. Es kommt zu erheblichen Geruchsbelästigungen.“
Da fällt mir doch die Pleiße ein, wie sie in den 70er Jahren durch Leipzig mäanderte. Oder die Gera durch Erfurt.
Ab Spittal wird die Drau immer wieder gestaut. Man kompensiert das schlechte Gewissen, ob des Eingriffs in die Natur, mit aufwändigen, von der EU bezahlten Projekten. Bei uns heißen sie Fischtreppen. Hier heißen sie Organismenwanderwege. Wir sind auch Organismen auf Wanderschaft – ich bin amüsiert.
In Spittal machen wir das erste Mal Bekanntschaft mit der „Türkengefahr“.
So bezeichnete man das während des 15. bis 17. Jahrhunderts im Gefolge der Türkenkriege in der europäischen Öffentlichkeit verbreitete Schreckbild des expandierenden Osmanischen Reiches als der Bedrohung des christlichen Abendlands durch eine islamische Macht. Mit Türkendrucken oder Turcica werden Flugschriften bezeichnet, die mit Hilfe des neu erfundenen Buchdrucks erstellt, vor der „Türkengefahr“ warnten.
Ganz unvertraut ist mir das irgendwie nicht. Mit ähnlicher Angstmacherei wie damals lässt sich auch heute die Auflage steigern und viel Geld verdienen. Die Türken kommen, die Russen kommen, der böse Wolf und nun kommt auch noch der joggerkillende Braunbär. Aus den damals kleinen Buch- und Flugblattdruckereien sind Konzerne geworden. Ich sage nur „Springerpresse“.
Schon 14 Uhr erreichen wir unser Ziel. Auf den letzten etwas zähen Kilometern haben wir uns gegenseitig Songs von Udo Lindenberg vorgesungen. Robert interpretiert überzeugend und mit entschiedenem Gesichtsausdruck Jonny Controletti, Andrea Doria und den Vampirsong. Ich versuche mich an Cello und dem Sonderzug nach Pankow.
Morgen ist schon wieder Sonntag. Sieben Wochen unterwegs und immer noch bester Dinge, trotz des Italientiefs. Nicht schlecht.

12.05.2023
43. Etappe
Von Gmünd nach Spittal an der Drau

Heute morgen frühstücken wir in Adelheids Pension. Warme Brötchen, selbstgemachte Marmelade, ein frisch gekochtes, wachsweiches Ei. Auf den Punkt. Das Ei und das ganze Drumherum auch.
Wir sitzen quasi im Wohnzimmer unserer Wirtin, sie selbst liest in der Küche nebenan die neueste Ausgabe der Kronenzeitung, das Pendant zur deutschen Bild.
Am Nachbartisch (es gibt nur zwei kleine Tische) sitzt eine Dame im Rentenalter. Allein reisend, Gespräche suchend, miteilungsbedürftig.
Mit dem üblichen woher, wohin beginnt sie das Gespräch. Klar kenne sie Schwerin, sächselt sie in österreichischer Mundart. Aus Oschatz hat sie rübergemacht, 88 war das. Jetzt ist sie Rentnerin. Hat sich nun endlich ihren Traum erfüllt. Mit Ölfarbe wollte sie schon immer malen und es nun von der Pike auf lernen. Zwei mal im Jahr kommt sie nach Gmünd. Hier in diesem Künstlerdorf werden Malkurse angeboten. Sie greift nach ihrem Smartphone, sucht, kommt zu uns an den Tisch. Robert geht schon in volle Deckung, er befürchtet ständig Fotos von Babys oder Katzen oder Hunden, zu denen er seine fachkundige Meinung sagen soll.
Aber so schlimm kommt es nicht. Gestern im Kurs hat sie ihren Hund gemalt. Auf einer 50x60 Zentimeter großen Leinwand. Ich kneife die Augen zusammen und bemühe mich, etwas zu erkennen. Meine Brille liegt noch oben in unserem schönen Zimmer auf dem Nachtisch. Tatsächlich ein Hund. Sieht ein bisschen aus wie Malen nach Zahlen, denke ich und bin beschämt über mich selbst. Hübsch ist er, guckt neugierig. Sie ist sehr stolz. Und ich bin berührt. Robert der Banause verleiert innerlich die Augen. Er denkt, ich merke es nicht. Ich sehe es ganz genau.
Es ist nicht der einzige wahr gewordene Traum in diesem Raum. An der Wand hinter mir entdecke ich kleine gerahmte Fotos. Adelheid, wie eine Squaw gekleidet zwischen Winnetou und Old Shatterhand. Ich traue meinen Augen nicht. Nein, es ist nicht der echte Winnetou (das sehe ich nun auch), aber es ist das echte Winnetou-Kostüm. Sie hat einen Urlaub gemacht und ist an die Plitvicer Seen gefahren. Die Naturidylle wurde nicht nur für die Gojko-Mitic-Indianer-Streifen, sondern auch für die berühmten Winnetou-Filme genutzt – in einer Höhle dort wurde „Der Schatz im Silbersee“ für die Dreharbeiten versteckt. Sie ist ein großer Fan. Spielt in einer Theatergruppe Szenen aus den berühmten Filmen nach. Pierre Brice war sogar schon in Gmünd, erfahre ich.
Ich erblasse vor Neid. Winnetou, Pierre Brice… meine erste große Liebe. Im Alter von etwa zehn Jahren habe ich ihm meine Gefühle gestanden. Den reich mit Herzen verzierten Brief habe ich in Klettbach in den Briefkasten geworfen. Ich spüre meine Aufregung von damals wie heute. Adresse: Pierre Brice/Paris. Lange habe ich gehofft, er hat mir nie geantwortet, der Schuft! Aber vielleicht hatte ich zu wenige Marken auf den den Brief geklebt oder die Stasi hat ihn einkassiert.
Gegen halb zehn verlassen wir diese wunderbare, seelenwärmende Szenerie. Brechen auf nach Spittal an der Drau. Der Himmel immer noch wolkenverhangen, aber es regnet nicht und es ist deutlich wärmer. Heute wandern wir auf der Fahrradvariante des Alpe-Adria-Trails. Ein Fernwanderweg , der über 750 Kilometer vom Grossglockner nach Triest führt. Der wird uns in den nächsten Wochen sicher öfter begegnen. Wir laufen auf kleinen Straßen auf halber Hanghöhe, haben tolle Ausblicke, kommen gut voran. Ich bin inspiriert von den Erlebnissen des Morgens.
„Robert, ich erzähle Dir jetzt mal, was ich mir alles noch im Leben so wünsche. Bist Du bereit?“
„Hhhhmmm“, macht es neben mir. Ich deute es als euphorische Zustimmung.
„Also. Einen kleinen Bauwagen hätte ich gerne. Der steht auf dem Flugplatz und jedes Wochenende fahren wir raus. Das ganze Wochenende. Ein Öfchen darin, eine kleine Bank und ein Tisch, ein Bett. Wir bauen ihn selber aus und wir sind Energieselbstversorger. Ich streiche ihn an, Gardinen nähe ich und eine Terrasse bauen wir auch noch. Meinst Du das geht?“
„Hhhhmmm“, antwortet Robert. Schon wieder dieser mutmachende Optimismus. Ich bin von der Socke.
„Dann hätte ich gerne einen eirunden Hängesessel, welcher an einer Laufkatze (die habe ich schon zum 50. bekommen) hängt und ich kann ihn durch das Antiquariat ziehen. Kriegen wir das hin?“
„Hhhhmmm,“ ertönt es nun zum dritten Mal. Ich werde misstrauisch.
„Und vielleicht noch eine 125er MZ RT?“ frage ich leise. Die haben wir doch im Motorradmuseum in Zschopau gesehen und die hat Dir doch auch so gut gefallen.“
Ob nun ein „hhhhmmm“ kommt oder nicht, meine Gedanken sind schon weitab. Da träume ich so vor mich hin von meinem Lieblingsleben und bin doch schon mittendrin. Ich habe alles, absolut alles, was ich brauche, und noch eine Portion Schlagoberst (österr. für Schlagsahne) drauf.
Ich suche nach dem Wort, das mein Dasein beschreibt. Perfekt? Nicht gut. Klingt nach makellos und anstrengend. Ich einige mich mit mir auf das Prädikat Vollkommen. Ja, mein Leben ist vollkommen. Bauwagen, Laufkatze, RT, alles überflüssiger Firlefanz, Klimmbimm. Nach weiteren zwei Kilometern denke ich leise: „Überflüssig ja, aber schön wäre es schon.“
Auf einer grünen Wiese am Wegesrand ist es dann passiert. Wir erleben unseren zweiten Frühling. Ein kleines, inneres Kichern schüttelt mich, während ich das schreibe. Es klingt ein bisschen… naja, wie soll ich sagen… anrüchig, gar frivol? Es bezieht sich ausschließlich auf die Vegetation, ich schwöre. Auf unserer Wanderung über den Alpenhauptkamm sind wir aus dem Frühling wieder in den Winter gewandert. Wir haben uns eine Schneeballschlacht auf dem Katschberger Pass geliefert, die Bäume waren wieder ohne Laub, kein Grün, keine Blüten. Nun sind wir wieder hinab gestiegen und der Flieder erblüht für uns ein zweites Mal in diesem Jahr.

11.05.2023
42. Etappe
Von Rennweg nach Gmünd

Die Mühen der Ebene – heute morgen stand fest: Das wird das Motto des Tages. Der Blick auf die Wetterkarte, der Blick auf die Wanderkarte, einfach nur trostlos. Österreich ertrinkt im Dauerregen, den das große und aufwändig angekündigte Italientief mit sich bringt. Unsere Wanderroute verläuft 14 von 19 Kilometern entlang einer gelben Bundesstraße. Ich sehe mich schon triefend nass und weinend am Straßenrand. Von oben der Regen, von der Seite der kalte Sprühregen, den vorbeirauschende LKW nebst kalten Windböen über mich ergießen. Einzig der Blick auf das abfallende Höhenprofil und der im Stundentakt verkehrende Bus sind ein Trost.
Wir sitzen beim Frühstück in unserer obergemütlichen Ferienwohnung und ich will nicht raus. Mit übertriebenen Putzaktionen verzögere ich den Abmarsch. Der Herd ist gewienert, die Spüle glänzt, ich putze sogar den Klobürstenbehälter, obwohl der niegelnagelneu ist.
Kurz nach neun gibt es kein Halten mehr. Raus mit uns.
„Ich fühle mich wie in Tschechien vor vier Wochen“ sagt Robert nach einer Weile. „Neun Grad, Regen und Gelatsche auf einer Landstraße.“ Ich stimme ihm zu, aber nur halbherzig. Ich habe dazugelernt, bin aus Erfahrung klug geworden. Im Vorbeigehen habe ich mir im ADEG, dem Dorfladen in Rennweg, einen Regenschirm gekauft. Sorgfältig wähle ich die Farbe aus. Optimistisch soll sie wirken, aber nicht grell. Bitte keine Streifen, das trägt auf. Und Karos wirken bieder. Nun schreite ich fröhlich dahin unter meinem petrolgrünen Knirps. Der Regen trommelt darauf und ich fühle mich wie unter dem Vordach eines kleinen gemütlichen Zeltes (statt vernünftigerweise einen knallroten Schirm zu wählen, nölt wieder einmal der Korrekturleser, damit uns die Autofahrer eher erkennen und nicht über den Haufen fahren, wählt Madame eitel die allgemein beliebte Tarnfarbe). Die Bundesstraße, auf der wir Hand in Hand nebeneinander gehen, ist kaum befahren. Aller naslang ein Handwerkerkleintransporter, ab und zu der Überlandbus. Ein kleines Auto mit einem Rentner, der zum Arzt oder zur Fußpflege nach Spittal hinab fährt. Der Fluss an unserer Seite murmelt kräftig und übertönt das Brausen der A10, die den Fernverkehr auf hohen, steilen Stelzen quasi über das Tal führt. Die bergige, grüne Landschaft ist nur schemenhaft zu erkennen, so tief hängen die Wolken. Nach Kilometer Zehn – unser Navigationsgerät verzeichnet den Rekord von 5 km/h – taucht eine kleine Kirche auf, ein paar Häuser, das übliche Gasthaus zur Post. Wir sind in Kremsbrücke angelangt. Kehren ein in eine Raststätte. Ein skurriler Mix aus Tankstelle, Supermarkt, Poststation, Bankschalter und Restaurant. Alles an der quasi kaum befahrenen Straße, im hier schmalen und felsigen Tal der Lies. Außer uns ist nur die Bedienung im weitläufig wirkenden Gebäude zugegen. Ob es hier immer so ruhig sei. wollen wir wissen. Oder ob das nur der Zwischensaison geschuldet ist? Die Besitzerin klagt uns ihr Leid. Nein, das ist nicht die Zwischensaison. Das ganze Tal stirbt aus. Von oben bis unten. Die Hotels und Restaurants schließen. Seit Corona ist das so. Touristisch war hier eh nie viel los.. so geht die Litanei.
Wir sind erstaunt. Das noble Salzkammergut, der totgetrampelte Dachstein, die überlasteten Wintersportorte, der teuerste Cappuccino in Radstadt, die monströs aufgeblasenen Skigebiete. Und nur wenige Tagesreisen von dort ist alles so anders. Und Tagesreisen bedeuten in unserem Fall maximal 20 Kilometer.
Nach einer weiteren Rast in einem kleinen Dorfcafé erreichen wir Gmünd.
Die Mühen der Ebene entpuppten sich als eine lustvoll-interessante Wanderung, trotz Dauernieseln und trotz Bundesstraße. Für mich ist eins klar: Mein Glück finde ich nicht auf den aussichtsreichen, perfekt vermarkteten, viel begangenen Trails, die einem eine Auszeit vom anstrengenden Arbeitsalltag versprechen.
Das Glück liegt, zumindest für mich, in jedem Tag unterwegs.

09.05.2023
41. Etappe
Von Mauterndorf nach Rennweg

Heute morgen sind wir in Sibirien aufgewacht. Im sibirischen Österreich. So bezeichnet der Volksmund den Lungau. Ein knapp tausend Quadratkilometer großes Hochplateau in den Niederen Tauern. Er ist im Westen und Norden von Hochgebirge begrenzt, im Osten und Südosten hingegen überschreiten die Berggipfel niemals die Almregion. Durch diese Öffnung nach Osten ist der Lungau kontinentalen Luftströmungen ausgesetzt, was der Gegend ausgesprochen strenge Winter beschert. Viel und lange Schnee, aber auch extrem sonnige und trockene Wintertage. Heute ist es weder kalt noch sonnig noch liegt Schnee. Schmuddelwetter, diagnostiziert mein prüfender Blick aus dem Fenster. Wir sind in Mauterndorf. Das Örtchen liegt an einer alten römischen Handelsstraße von Venedig in den Norden. Filmkulissenreife Idylle im historischen Gewand zeugt vom einstigen Wohlstand des Ortes. Überragt von einer Burg. Hermann Göring hat hier seine Kindheit in der Sommerfrische verbracht und Ende April 1945 wollte er noch auf die Burg fliehen. Aus Angst vor einem Vordringen der Roten Armee entschied er sich jedoch dagegen. 1938 soll ihm angeblich eine Ehrenbürgerschaft verliehen worden sein. Er hatte sich um den Neubau einer Wasserleitung verdient gemacht. Davon will aber heute niemand mehr etwas wissen und mögliche Beweise sind dünn und spärlich. Was sicher ist und bewiesen: Eine Werbetournee zum „Anschluss“ Österreichs brachte Göring am 31. März 1938 nach Mauterndorf, wo ihm 8000 Lungauer einen begeisterten Empfang bereiteten.
Ich freue mich auf unsere Wanderung. Heute gehen wir über den Katschberger Pass. Er verbindet den Lungau mit Kärnten. Seine mittlere Steigung beträgt dreizehn Prozent, wobei die Nordrampe von St. Michael im Lungau eine 20prozentige, die Südrampe von Rennweg eine 18prozentige Steigung auf einem Teilstück aufweist. Für Wohnmobilisten ungeeignet. Nicht aber für Motorradfahrer. Das Katschbergrennen war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine gefürchtete Teiletappe der Alpenfahrt für Motorräder.
Im Gegensatz zum Tauernpass gibt es hier einen schönen Wanderweg, der das Niveau der Straße nur unwesentlich überschreitet. Gemächlich und ruhig steigen wir auf 1640 Meter. Eine halbe Stunde vor Erreichen des höchsten Punktes verschlucken uns die Wolken. Die Stimmung ist gespenstisch. Wir laufen durch Nebel. Dunkle Wiesen mit Resten von verharschtem Schnee öffnen sich steil nach oben. Verwaiste Schneekanonen recken ihre dürren Ärmchen empor. Riesige Liftanlagen tauchen schemenhaft auf. Gondeln hängen, wie aufgeknüpft, bewegungslos im klammen Dunst. Stille – kein Vogelgezwitscher wie noch unten im Tann. Modrige Baumstümpfe geben Zeugnis von ehemaliger Vegetation. Lautsprecher und Scheinwerfer wachen mit toten Augen und Mündern über die wie ausgestorbene Szenerie. Wir ahnen menschenleere Hotelanlagen. Wir sind hier oben die einzigen, weit und breit. Mich gruselt es. Es ist Zwischensaison. Ich glaube, hier bekommen wir keinen warmen Tee. Bloß weiter.
Der Abstieg ist die blanke Sahne. Immer bergab, erst gemächlich, dann hinab durch eine steile Scharte. Die Sonne scheint wieder. Unterwegs machen wir eine Entdeckung. 200 Meter unter uns öffnet sich der Berg und spuckt Autos aus, so groß wie Marienkäfer. Direkt unter unseren Füßen verläuft der sechs Kilometer lange Katschbergtunnel. Er ist Teil der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung zwischen Salzburg und Villach. Da sind wir auch schon etliche Male durchgefahren auf unseren Ausflügen in den Süden. Jetzt stehen wir im wahrsten Sinne des Wortes darüber. Nach einer halben Stunde kommen wir in unserer Ferienwohnung an. Ist das schön hier! Eine Küche, ein großer Tisch mit Bank. Ein Schlafzimmer und ein eigenes Bad. „Robert, können wir hier einen Tag bleiben? Pause machen, Regen abwarten, ausruhen?“ Er ist einverstanden und ich bin sehr froh darüber.

08.05.2023
40. Etappe
Von Radstadt nach Mauterndorf

7:30 Uhr. Das Telefon klingelt. Robert schnarcht noch leise vor sich hin. Ich habe mich ins Bad geschlichen, wollte ihn nicht wecken. Mit der Zahnbürste im Mund stürze ich mich aufs Telefon, wische mit noch nassen Fingern auf dem Display herum und nuschele etwas unwillig, den Mund voll Zahnpasta, eine Begrüßungsfloskel in mein Händie.
„Ja. Guten Morgen auch“, höre ich eine freundliche, optimistische und wohlbekannte Stimme auf der anderen Seite. „Ist denn das Geburtstagskind schon wach?“
„Mensch Micha“, sage ich, „jetzt bist du der erste Gratulant.“ Eigentlich wollte ich das sein, dass er mir nun die Tour vermasselt hat, verschweige ich ihm.
„Robert, aufwachen! Micha ist am Telefon.“
„Welcher Micha?“ nuschelt der noch Halbschlafende.
„Na unser Micha vom Flugplatz, kennst du sonst noch einen anderen Micha?“
„Aaahh.“
Langsam findet er sich wieder in der Realität zurecht. Ich übergebe das Telefon und mein Liebster nimmt die Kondolation artig entgegen.
Wir sind im 8. Mai angekommen. Eine gute halbe Stunde später haben wir unser Krämchen gepackt, sitzen in der Bäckerei gegenüber unserer Pension und trinken einen Cappuccino. Der kostet 4,80 Euro. Wohlgemerkt einer. Ein neuer Rekord.
Wir haben es nicht eilig und halten ein bisschen Rückschau. Früh am Tag waren wir gestern hier. Halb zwei schon saßen wir auf der Terrasse des Restaurant Stegerbräu. Die Sonne schien uns warm ins Gesicht. Der Ausblick über das grüne, weite Tal auf das schneebedeckte Tauernmassiv – grandios.
Das große Restaurant ist übervoll mit fein gekleideten Menschen und der Kellner heilfroh, dass wir mit zwei Gläsern Bier vollauf zufrieden sind.
Bunte Dirndl mit weit schwingenden Röcken, kernige Lederhosen, weiße, gestrickte Wollstrümpfe über strammen Männerwaden. Trachten ersetzen hier die Kostüm-, Schlips- und Anzugkultur, wie sie bei uns zu Feierlichkeiten üblich ist. Sogar die ganz Kleinen sind schon so unterwegs. Das sieht sehr putzig aus.
Beim Händewaschen in der Damentoilette treffe ich ein etwa 8jähriges Mädchen. Wie eine Prinzessin sieht sie aus in ihrem langen weißen Spitzenkleidchen, feinen weißen Schühchen, dazu ein Kranz aus weißen Blumen im langen blonden Haar. Sie ist emsig bemüht, einen Soßenfleck von ihrem Gewand zu wischen. Ich helfe ihr ein bisschen und auf meine Frage, warum sie denn heute so chic sei, antwortet sie mir, heute sei Erstkommunion in Radstadt. Ahja. Das erklärt den ganzen Trubel und auch den katholischen Priester nebst Nonne am Nachbartisch.
Während wir unser Bier trinken, lesen wir etwas über die Geschichte der Stadt. Wir erfahren, dass in den Jahren 1731/32 ca. 3000 Protestanten die Stadt verlassen mussten. Das Emigrationspatent des Erzbischofs von Salzburg ordnete die Ausweisung der etwa 20.000 Salzburger Protestanten an. Zunächst wurden 4000 grundbesitzlose Mägde und Knechte gefangen und deportiert. Ab Mai 1732 wurden vor allem Handwerker- und Bauernfamilien des Landes verwiesen. Fast ein Viertel der Ausgewiesenen überlebte die mühsamen Märsche im Zuge der Vertreibung nicht. Alle Protestanten, die älter als zwölf Jahre waren, hatten das Land innerhalb von acht Tagen zu verlassen. Die Bauern bekamen zwölf Wochen Zeit, ihren Besitz zu verkaufen. Insgesamt, so schätzt man, mussten 17.000 Menschen auswandern. Bis 1837 wurden „überführte“ Protestanten des Landes verwiesen.
König Friedrich Wilhelm I. in Preußen erklärte sich bereit, die Vertriebenen in seinen entvölkerten Ostprovinzen anzusiedeln. Mittellose Bauern bekamen hier vom preußischen König ein Stück Land zur Verfügung gestellt, Handwerker konnten ihrem Gewerbe in den Städten ungehindert nachgehen.
„Robert, sag mal, kommt uns das nicht bekannt vor? Wiederholt sich Geschichte denn immer?“
Etwas zornig und bockig beäuge ich mit diesem Wissen den Schwarzberockten und die Ordensschwester am Nachbartisch aufmerksamer bei ihrer Fettlebe. Braten und Schwarzbier, Eiskugeln mit Schlagsahne und Likör verschwinden in ihren Schlünden – sicher auf Kosten der Eltern. Wenn mein Verein soviel Dreck am Stecken hätte, da würde mir der Appetit vergehen. Ehrlich.
Aber zurück in die Bäckerei, zurück zum Cappuccino, zurück zum heutigen Festtag. Den lasse ich mir nicht durch trübe Gedanken vermiesen. Geburtstag auf Reisen bedeutet folgendes: Robert hat freie Wahl, was die Tour betrifft, und am Abend gehen wir Essen und schlagen über die Stränge (Robert jedenfalls).
Die schönsten Touren sind für meinen Wandergefährten die, bei denen man ohne große Anstrengung möglichst viele Kilometer zurücklegt. Wir spazieren also drei Stunden nach Untertauern ohne nennenswerte Steigungen und nehmen dann den Bus über den 1700 Meter hohen Tauernpass nach Mauterndorf. Ich grummele etwas, aber Geburtstag ist Geburtstag. Es ist eine vernünftige Entscheidung. Der Wanderweg über den Pass führt auf über 2000 Metern nach Obertauern und ist tief verschneit. Die Landstrasse kurvig, steil und viel befahren. Das eine ist genau so gefährlich wie das andere. Im Bus sitzen wir ganz vorne und haben eine tolle Aussicht.
Beim Geburtstagsessen erfüllt sich Robert seinen beständigen Traum von der Völlerei (Der Korrekturleser ist sprachlos: Einmal im Jahr wird man sich doch satt essen dürfen!). Ich kenne keinen, der so viel essen kann wie dieser Mensch. Mir und auch dem Kellner stockt der Atem, als Robert energisch erst die Spargelsuppe, dann den Saibling blau mit Kartoffeln und Gemüse und dann noch den panierten Saurüssel mit Kartoffelsalat bestellt. Ich erröte beschämt und fasele etwas Entschuldigendes, von wegen Geburtstag und so, und schäme mich, dass ich mich schäme. Auch der Kellner beschwichtigt die Gier (Was denn für eine Gier, ich hatte ein kleines Hüngerchen!) leicht ungläubig so nach dem Motto: Ich bringe erst mal die Suppe und den Saibling und wenn sie dann noch Hunger haben, dann…
Es gibt ein „Dann“ und auch der Saurüssel wird serviert. Mein liebes Geburtstagskind ist überglücklich. (Naja, ein Stück Kuchen zum doppelten Espresso wäre nicht schlecht gewesen, aber dann hätte man mich vielleicht für einen Vielfraß gehalten…).

07.05.2023
39. Etappe
Von Schladming nach Radstadt
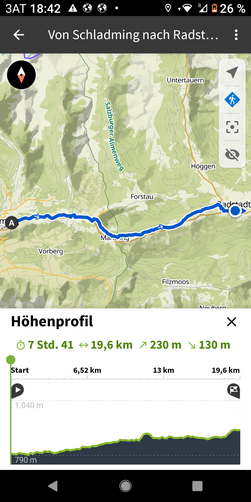
In Schladming haben wir uns gefühlt wie in Oberwiesenthal. Da waren wir zu Ostern. Ich erinnere mich gut daran. Da wussten wir noch nicht, wer Viola Bauer war und das übliche Schlüsselkästchen am Eingang unserer Pension (den Code bekommt man vorab per SMS geschickt) war leer. Meine Güte, ist das lange her.
Wenn ich sage Oberwiesenthal, dann stimmt das nicht ganz. Eher ein um das dreifache aufgepustete Oberwiesenthal.
Schladming ist wie sein kleines erzgebirgisches Pendant ein wichtiger Wintersportort und war Austragungsort der Alpinen Skiweltmeisterschaften 1982 und 2013 sowie der Special Olympics in den Wintern 1993 und 2017.
Der größte Tourismusmagnet ist die 4-Berge-Skischaukel, die Schladming mit der Planai verbindet. Eine Skischaukel? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ich bin ratlos und finde folgende Antwort: „Als Skischaukel bezeichnet man die touristische und verkehrstechnische Verbindung von in verschiedenen Tälern gelegenen Skigebieten über die Höhenzüge, die diese Täler trennen." Alles per Seilbahn. Aha.
Bekannt ist dieses Skigebiet vor allem durch das Nightrace, den Nachtslalom, dem alljährlich zirka 50.000 Besucher beiwohnen. Auch das noch.
Im Tourismusjahr 2015 (November 2014 bis Oktober 2015) verzeichnete Schladming 1.547.748 Nächtigungen.
Anderthalb Millionen Sport- und Skibegeisterte fallen wie die Heuschrecken über das kleine Bergbaustädtchen her.
Im Vergleich dazu: 2018 nächtigten in Oberwiesenthal 612000 Menschen.
Gut, dass Zwischensaison ist. Ich würde ja ne Meise kriegen.
Heute folgen wir dem wild dahin strömenden Flüsschen Enns in Richtung Westen. Wir umgehen das Tauernmassiv, das sich nun, nachdem wir den Dachstein umfahren haben, vor uns auftürmt. Es gibt ganz schön viele Berge in Österreich. Wer weiß, was als nächstes kommt.
Es ist eine angenehme 19-km-Tour. Wir gehen flußaufwärts. Ein Skigebiet reiht sich an das andere. Aaaah die Skischaukel. Ich erinnere mich.
Ich entwickele meinen Plan vom sanften Skitourismus und der geht so. Grundthese: Wer den Berg runterfahren will, der muss auch aus eigener Kraft rauf kommen. Ich musste meinen Schlitten auch den Klettbacher Rodelhang hochziehen und niemand hat mich hochgezerrt.
Zur Erleichterung gibt es eine kleine, solarbetriebene Seilwinde. Daran hängen kleine Schlitten, auf die man sein ganzes Gerassel packen kann, was man beim Hochsteigen nicht braucht. Ski, Stöcke, Skistiefel, Helm etc. Die Tageskarte zur Benutzung kostet 5 Euro. Im Service inbegriffen ist ein in Serpentinen ausgetrampelter Weg zum Gipfel. Oben kann man dann seine Wanderschuhe gegen die Skischuhe tauschen und mit dem Schlitten wieder nach unten befördern.
Apré Ski bedeutet ein Glühweinstand mit selbstgemachtem Glühwein. Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet.
„Robert, wie findest Du meine Idee?“ frage ich meinen Begleiter, der wie immer schweigend neben mir hertrottet und meine Visionen erträgt. Seine Antwort macht mich froh: „Huhni, gut finde ich das. Friede würde einkehren im Ländle, die Bäume würden wieder wachsen, der Hirsch wieder röhren und die Besucherzahlen würden auf das Niveau von 1890 zurückgehen.“ Dabei belassen wir es.

06.05.2023
38. Etappe
Vom Hallstätter See nach Schladming

Seit Tagen wandern wir direkt auf das Dachsteinmassiv zu. Erst zeichnete es sich blassgrau am Horizont ab mit seinen schneebedeckten Spitzen. Davor, noch viel deutlicher, lag der kleine Gebirgszug „Hausruck“. Das ist nun alles Geschichte. Heute stehen wir vor diesem Klotz, glotzen nach oben und stellen diesem Steinriesen ein Ultimatum. Entweder Du gehst uns aus dem Weg oder… wir nehmen die Eisenbahn und fahren um Dich herum. Überlege Dir das gut! Möchtest Du das wirklich? Wir erhöhen den Druck und geben ihm nur zwei Minuten Bedenkzeit. Wider Erwarten reagiert er nicht. So ein Sturkopf. Nun gut, dann müssen wir eben zum Äußersten greifen.
Wir können tatsächlich nicht darüber gehen. Jedenfalls im Moment nicht. Die Wandersaison beginnt am 1. Juni. Da oben ist noch tiefster Winter und wir sind nicht entsprechend ausgerüstet. Wir hadern nicht damit. In den Alpen ist gerade Zwischensaison. Der Winterskispaß ist vorüber, der Sommergaudi hat noch nicht begonnen. Wege sind gesperrt, weil sie gewartet werden, Seilbahnen fahren nicht aus den gleichen Gründen. Hotel- und Restaurantbesitzer renovieren oder inventarisieren oder machen einfach mal nur Urlaub. Die Berge und seine Bewohner gönnen sich eine Verschnaufpause.
Wir könnten das Massiv umgehen. Auch das haben wir geprüft. Drei Tage würde es dauern und wir hätten die Zeit. Drei Tage und 500 Euro weniger auf dem Konto. Es ist einfach zu teuer hier. Nichts wie weg.
Vorher gönnen wir uns noch 12 km vom Feinsten. Wir spazieren am Ostufer des Hallstätter Sees nach Obertraun. Immer den majestätischen Dachstein im Blick. Der See ist fjordartig in das Gebirge eingeschnitten. Auf allen Seiten geht es steil in die Höhe. An seinem Westufer klebt Hallstatt.
Auf dem schmalen Uferstreifen zwischen dem See und dem steilen Berghang drängen sich die Häuser dicht aneinander, sind teilweise sogar mit Pfählen in den See gebaut. Im Wesentlichen besteht der alte Hauptort aus einem Straßenzug parallel zum Seeufer und einigen Gassen um den Marktplatz. 900 Menschen leben hier. Jährlich erträgt dieser Ort 600.000 – 700.000 Tagestouristen, vorwiegend aus Asien.
Lange vor dem Tourismus war Hallstatt aufgrund seiner Salzkammern bekannt. Noch heute besitzt Hallstatt das älteste aktive Salzbergwerk der Welt.
Seit 1607 und bis heute wird die Sole von Hallstatt bis ins Sudwerk in Ebensee am Traunsee (etwa 40 km) durch eine Leitung transportiert. Diese Industrie-Rohrleitung, die älteste noch aktive der Welt, wurde ursprünglich aus aufgebohrten Nadelbaumstämmen gebaut und ganz nebenbei kann man darauf wandern, genau wie wir es in den letzten Tagen getan haben.
Es ist gut, dass wir in der Zwischensaison hier sind. Der wunderbare Wanderweg gehört uns fast alleine. Wir frühstücken in Obertraun am Bahnhof und bestaunen dabei wieder den Dachstein. Ich kann mich gar nicht satt sehen. So erhaben, so majestätisch, so wunderschön. Wie selten hat dieser König seine Ruhe. Seilbahnen, Aussichtsplattform, Skilifte, über Hubschrauber bewirtschaftete Hütten, im Sommer die Wanderer und Biker, im Winter die Skifahrer und Skitourengeher. „Robert, wir haben das damals auch gemacht. Weißt Du noch? Mit dem Auto nach Österreich getobt, dann fünf Tage Hüttentour mit Klettersteigen ,gemachtʻ und dann wieder 1500 km zurückgefahren. Warum waren wir so dumm?“ (Naja und JaJa, wirft gedanklich der Korrekturleser Robert ein, aber „gefetzt“ hat es trotzdem.)
Mit dem Zug fahren wir nach Schladming. Menschen mit Helmen auf dem Kopf und kleinen Plastebooten unter dem Arm steigen ein. Ach, das hatte ich ja ganz vergessen. Man kann hier auch Rafting und Canyoning betreiben. Die Alpen – der größte Abenteuerspielplatz Europas.

05.05.2023
37. Etappe
Von Bad Ischl zum Hallstätter See

Zwänge, Ängste, Schweinehunde. Die lauern nicht am Wegesrand wie die Räuber und sie können auch nicht über
uns hereinbrechen wie Unwetter. Sie wohnen in uns, sind oft durch Vermeidungsstrategien ins Abseits gedrängt, streben ans Licht, wollen überwunden sein. Unsere äußere Reise durch Europa ist auch eine durch unser Innenleben.
Gestern haben wir stundenlang nach einer Übernachtung für den nächsten Tag gesucht. Es gibt sie wie Sand am Meer. Aber im Salzkammergut kostet beinah jedes Doppelzimmer über 150 Euro. „Das teuerste Pflaster Österreichs“, erklärt uns unsere Wirtin. Na vielen Dank auch. Wir hätten das Geld, sind aber nicht bereit, es auszugeben. Dann dieses ewige vorwärts, vorwärts.
„Robert, wenn Du uns weiter so hetzt, sind wir in zwei Monaten da.“
Sigá sigá – das ist griechisch und bedeutet: Immer mit der Ruhe. Und zu guter Letzt dieses verdammte Wetter. Ich hasse Gewitter. Jedenfalls wenn ich in den Bergen wandere und jetzt sind hier drei Tage Unwetter angesagt. Wir sind auf der Reise unseres Lebens, sitzen auf dem Balkon einer urigen Ferienwohnung, welche gerade mal 60 Euro gekostet hat, mit Blick über Bad Ischl und sind irgendwie nicht ganz froh.
Wie zum Lohn bekommen wir heute einen wunderschönen Spaziergang geschenkt. 15 km durch bezaubernde Berglandschaft, entlang des Flusses Traun. Ich kann den Blick nicht wenden vom Dachsteinmassiv, auf welches wir direkt zusteuern. 2995 m hoch ist der Dachstein. Er ist der höchste Berg in dieser Gruppe und nördlichster Gletscher in Personalunion. In der Eiszeit reichte dieses Gebilde bis weit ins Alpenvorland hinein. Genauer gesagt bis zum Hausruck. Da sind wir doch erst vor wenigen Tagen gewesen. Bei seinem Rückzug hinterließ er uns smaragdgrüne Alpenseen. Der Wolfgangsee, der Traunsee, der Hallstädter See und andere. Auch mit denen durften wir Bekanntschaft machen. Wir hatten die Ehre.
Frühstück findet, als wäre es nie anders gewesen, im Freien statt. Und wie das schmeckt. Was in Tschechien Hörnchen mit Käse-Eckchen ist nun Roggenbrot mit Butter und Radieschen. Das esse ich jetzt jeden Tag, solange wir in Österreich sind. Dann kommt Tomate mit Schafskäse. Mal sehen.
In Bad Goisern treffen wir auf ein altes Handwerk. Schuhe werden hier geschustert. Wanderschuhe der Luxusklasse. Und wer hat sie dazu gemacht?
Kaiser Franz Joseph, der sich oft im benachbarten Kurort Bad Ischl in seiner Sommerresidenz aufhielt, war passionierter Jäger und Besitzer von Schuhen aus der Goiserer Schuhwerkstatt. Denn für alpines Gelände waren die doppelt genähten, stabilen Goiserer, wie sie Kenner nennen, optimal. Ihren Weltruf als Wanderschuhe genießen sie bis heute. Der originale Goiserer hat sich kaum verändert, lediglich die Sohle ist mittlerweile aus Kunststoff. Die ehemals lederne und mit Eisennägeln beschlagene Originalsohle ist heute ungebräuchlich.
Es gibt eine kleine, unscheinbare Werkstatt in diesem Ort. Ein einziger Schuster fertigt diesen Schuh. Oder ist es vielleicht schon Fetisch? 1500 Euro kostet ein Paar dieser angeblich unverwüstlichen Originale mit Adelstitel. Der Fuß handvermessen, das Leder von einem glücklichen Almrind, Wartezeit etwa ein Jahr. Nichts für uns Sparfüchse. Unsere Wanderschuhe haben 250 Euro gekostet und das empfinden wir schon fast wie ein Vermögen. Im Übrigen… wir haben mindestens drei Packungen Blasenpflaster geschenkt bekommen und nicht ein einziges haben wir bis jetzt gebraucht.

04.05.2023
36. Etappe
Von Altmünster nach Bad Ischl

„Im weißen Rößl am Wolfgangsee“.
„Was kann der Sigismund dafür das er so schön ist“.
„Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein“.
„Mein Liebeslied muß ein Walzer sein“.
In meinem Gehörgang stehen die Ohrwürmer Schlange und drängeln. Wir sind im Salzkammergut. In DEM Salzkammergut.
Und damit meine ich nicht den Schauplatz der schmierigen Schlagerrevue mit Peter Alexander aus den wirtschaftswunderbetäubten späten 50ern. Ich wippe innerlich im Takt zum Original. „Im weißen Rößl“ ist ein Singspiel von Ralph Benatzky aus dem Jahr 1930.
Die Ur-Fassung ist ein temporeiches, tänzerisches und vergnügliches Beispiel des legendären
Unterhaltungstheaters der Weimarer Republik, von den Revuebildern der Wilden Zwanziger bis hin zur augenzwinkernden sprachlichen und musikalischen Konfrontation der österreichischen Alpen mit der Berliner Geschäftswelt.
Es ist greller und jazziger als das heute gespielte 1950er-Jahre-Arrangement. Es hat eine hörbare Nachbarschaft zur zwei Jahre zuvor uraufgeführten Dreigroschenoper-Musik Kurt Weills, ebenso wie eine Nähe zum gerade entstehenden Tonfilmschlager und den großen Berlin-Revuen der 1920er Jahre.
Das Werk war im nationalsozialistischen Deutschland wegen seiner jüdischen Mitautoren verboten und wegen des despektierlichen Umgangs mit „Folklore“ als „entartet“ gebrandmarkt.
Einen Sommer lang habe ich dieses wunderbare Stück gespielt, zwei Vorstellungen am Tag. In Schönebeck beim Sommertheater auf dem „Bierer Berg“. Das war ein Spaß. Und sogar Geld habe ich für den Gaudi bekommen.
Das Zentrum des Salzkammergut ist Bad Ischl. Hier steppte der Bär zu Glanzzeiten der k.u.k. Monarchie. Hier residierte Kaiser Franz Joseph der I. mit seiner Gemahlin Elisabeth von Bayern, uns besser bekannt als Sissi. „Robert, die Trilogie über die Kaiserin gibt es bei Netflix, habe ich gesehen. Die müssen wir uns anschauen. Unvergessen die junge Romy Schneider.“ Ich bin euphorisch, Robert schweigt. Ich befürchte, diese Schmachtfetzen würde er nervlich nicht durchhalten.
Schon gestern Abend habe ich mich belesen über diesen legendären Ort. Johannes Brahms, Anton Bruckner, Franz Lehár, Johann Strauß. Wer sich da so alles herumtrieb. Böse Zungen behaupten, es ging den Kunstschaffenden eher um die Nähe zum Hof als um die Gesundheit. Ich kann mir das gut vorstellen. Hofschranzen. Speichellecker oder wie man heute sagen würde Netzwerker oder Lobbyisten.
Noch zwei delikate Details weist die Geschichte der Stadt auf.
Am 28. Juli 1914 verfasste Kaiser Franz Joseph I. in der Kaiservilla in Bad Ischl das Manifest „An Meine Völker!“, in dem er dem Königreich Serbien den Krieg erklärte. Dies sollte der Beginn des Ersten Weltkriegs werden.
Im April 1945 wurden in einer Saline in Bad Ischl 20 Kisten mit Privatbriefen Adolf Hitlers, der Kunstschatz des Klosters Monte Cassino, die gesamte Rothschild-Sammlung, der Genter Altar sowie Gemälde von Rembrandt, Rubens, Leonardo da Vinci, Tizian, van Dyck, Raffael, Breughel, Goya und Michelangelo gefunden.
Was sagt man denn dazu? Dafür keine Stadtbrände, nicht Pest und Cholera und auch keine Verwüstungen im zweiten Weltkrieg.
Als wir gegen 14 Uhr hier ankommen, sind meine Erwartungen riesengroß. Ich erwarte ein ähnliches architektonisches Spektakel wie in Karlsbad. Mitnichten. Das soll nun die Sommerresidenz des Kaisers sein? Und das der Garten von „Sissi“? Irgendwie popelig alles.
Am frühen Abend spazieren wir noch einmal über die Kurpromenade. Die Sonne scheint warm und mild. Aufgetakelte alte Damen mit großen Hüten, überdimensionierten Sonnenbrillen und grell geschminkten faltigen Lippen sitzen in den Restaurants und Cafés im Gründerzeitstil. Die Bäume der Promenade entfalten ihr zartes Grün. Ein wunderschöner grüner Bergfluss fließt mitten durch den Ort. Als wäre das nicht kulissenhaft genug, erheben sich direkt dahinter die schneebedeckten Berge. Wir lassen uns nicht verführen und trinken keine überteuerten Getränke an diesem weltfremden Ort. Wir kaufen uns ein Kilo Kartoffeln und Eier und eine Flasche Wein aus dem untersten Regal. Wir haben heute eine Küche und kochen mal wieder selber. In der untergehenden Sonne sitzen wir satt und zufrieden auf unserem Balkon und schauen in die Berge.
Das Dachsteingebirge vor der Nase. Da müssen wir drüber.

03.05.2023
35. Etappe
Von Vöcklabruck nach Altmünster

Heute morgen wache ich mit Kopfschmerzen auf. Daran ist nicht der Wein Schuld – versprochen. Robert liegt stocksteif neben mir im Bett, traut sich nicht, sich zu bewegen. Ihm tut die Schulter und der Nacken weh. Meine Güte, was für ein Versehrtenkabinett.
Zehn Minuten Yoga mit Mady Morrison für Schulter und Rücken sollen uns wieder auf die Beine helfen. „Einatmen und Arme heben, halten, ausatmen und loslassen“, säuselt die athletische, vegan ernährte, durchtrainierte Youtuberin mit zigtausend Abonnenten. Brav turnen wir der guten Frau nach, in der Hoffnung auf Linderung. Obwohl ich angehalten bin, die Augen sanft zu schließen und in mich hinein zu fühlen, beobachte ich meinen Mitturner heimlich aus den Augenwinkeln. Der ist ja steif wie ein Brett und gelenkig wie ne Brechstange, der Arme.
Gegen halb neun treten wir im Nieselregen aus unserem Hotel auf den Stadtplatz von Vöcklabruck. Wir steuern direkt das kleine Café auf der Straßenseite gegenüber an. Das Frühstück im Hotel für 12 Euro haben wir abgewählt und auch hier trinken wir nur einen Kaffee. Vöcklabruck ist ein teures Pflaster. Der Hauch von Bad Ischl weht herüber.
Beim Kaffee rede ich ernste Worte. „Robert, so können wir nicht weitermachen und so war es auch nicht ausgemacht. Die letzten beiden Tage sind wir je 25 km gelaufen. Das, was vor einigen Wochen noch die Ausnahme war, scheint Normalität zu werden. Dieses Tempo halten wir nicht durch. Gestern sind wir um 17 Uhr hier angekommen, heute geht es früh weiter. Zu wenig Zeit, um zu regenerieren. Wir sind nicht mehr jung. Es kann doch nicht sein, dass wir Ibuprofen gegen Rücken- oder Kopfschmerzen nehmen müssen, um die Tagesetappe zu schaffen.“
So oder so ähnlich rede ich leise auf ihn ein. Er schweigt dazu, wie gewöhnlich. Er weiß, dass ich Recht habe. (Glaubt das Hühnchen wenigstens, grinst der Korrekturleser Robert.)
Nach ein paar Einkäufen für unterwegs verlassen wir die Stadt. 12000 Menschen leben hier. Die Stadt hat einen ICE-Anschluss.
„Robert rate mal, wie viele Intercity Züge in diesem Kaff täglich halten?“
Er denkt eine Weile nach. „Wenn Du schon so fragst, dann sage ich mal 10.“
„Nein, mehr“, antworte ich und mache es spannend. „
20?“ schätzt er weiter?
„Nein, Robert, jeden Tag halten hier 30 dieser Züge“, sage ich mit einem gewissen Triumph in der Stimme ob dieser unerhörten Neuigkeit und genieße seinen verwunderten Blick.
Aus pragmatischen Gründen haben wir heute eine Tour gewählt, die eigentlich für Fahrradfahrer vorgesehen ist. Sie ist kürzer und weist weniger Höhenunterschiede als die Wanderroute auf. Unser Ziel ist Altmünster am nordwestlichen Ufer des Traunsees. Aus touristischer Sicht ist diese Etappe lausig. Hier würden wir nie wandern, hätten wir nur eine oder zwei Wochen Urlaub. Unser Weg führt durch Gewerbegebiete, entlang großer Straßen, mehrmals unterqueren wir die Autobahn. Robert legt mir eindrücklich dar, dass dies nur eine Frage der Sichtweise ist: „Wald, Wald immer nur Wald. Das Nonplusultra der Erholung. Waldbaden als Methode zur Entschleunigung. Wald als Oase für gestresste Großstädter. Aber sieh nur die Vorteile unseres Weges. Inspiration durch die glänzenden Ausstellungen in den Autohäusern, jede Menge riesige, knallbunte Werbeplakate. Statt Vogelgezwitscher das einlullende Säuseln der Motorengeräusche, beruhigender Lärm der Zivilisation. Garantiert kein Problembär, keine matschigen Waldwege, auf denen kaum ein Vorwärtskommen ist und immer der Blick auf den grünen Wald in der Ferne. Den sieht man ja bekanntlich vor lauter Bäumen nicht, wenn man mittendrin ist.“
Und dann kommt noch die Krönung. Bei der BP-Tankstelle am vierspurigen Autobahnzubringer, nach Kilometer 6 unserer Wanderung, gibt es Hendl. (Grillhähnchen). Schnell wird die Biergartengarnitur trockengewischt und wir sitzen gemütlich auf schwarzem Asphalt im Benzingeruch und teilen uns ein halbes Hähnchen mit Pommes. Es geht uns gut. Die Welt ist wieder in Ordnung. Im Wald wäre uns das nicht passiert.

02.05.2023
34. Etappe
Von Eberschwang nach Vöcklabruck

Kleine Robertsche Abschweifung 7
Was in Tschechien die bienenfleißigen Asiaten sind, die die werktätige Bevölkerung aus ihren Minigeschäften heraus an Sonn- und Feiertagen mit alkoholischen Erfrischungsgetränken versorgen, sind in der österreichischen Provinz die Getränkeautomaten. Im Großdorf Eberschwang gibt es zwei davon.
Am 1. Mai, Kampftag der internationalen Arbeiterklasse, sind alle Kneipen zu. Wir kommen dürr wie zwei Backpflaumen hier im Ort an. Martina faselt und phantasiert von einem zu erwartenden Biergarten. Pustekuchen. Also wird die einheimische Bevölkerung, mit der wir uns im Rahmen der Völkerverständigung stets anfreunden möchten, befragt. Ja, da und dort, Bierautomat. Wir sofort hin.
Vor uns ein halbwüchsiger Bub, keine 15 Jahre alt. Souverän tippt er die Produktnummer, hält eine Geldkarte an ein Lesegerät, es rumpelt und die Bierbüchsen kullern heraus. Wir hoffen, dass der Vater seinen Sohn mit der Geldkarte, die gleichzeitig auch das Alter des Kunden ausspuckt, ausgestattet hat. Denn erst ab 18 wird in Österreich die Bierbüchse frei gegeben. Ohne Geldkarte mit Alterserkennung – kein Bier.
Der Bub zieht mit seiner Beute ab, nun sind wir an der Reihe. Sobald wir die Produktnummer eingegeben haben, werden wir zur Altersidentifizierung aufgerufen. Locker ziehen wir unsere beiden in Frage kommenden Geldkarten. Und nichts passiert. „Altersfreigabe nicht erkannt“, werden wir informiert. Wir versuchen alle Varianten: Karte von vorne, von hinten, schnell darüber, langes dranhalten, dann gibt es einen Schlitz, da versuchen wir, die Karte hineinzupressen, ich springe mit erhobener Karte am Lesegerät vorbei, am Ende drücken wir unsere runzeligen Gesichter auf das Display, das muss doch klappen. Alterserkennung ist das Stichwort. Alle Versuche scheitern. Wir sind völlig am Boden. Der Staub rieselt aus den Mundwinkeln. Da ist schonmal jemand vor dem Bierautomat verdurstet.
Doch die Rettung naht. Ein Auto quietscht heran, es entsteigt ein bis über die Ohren bunt tätowierter Mittdreißiger oder Mitfünfziger. „Können Sie uns helfen?“ hechelt Martina, ohne eine Begrüßung für nötig zu halten. Wir versichern glaubhaft, dass wir über 18 sind und uns wird geholfen. Seine Karte, die ihn als volljährig ausweist, versteht dieses Drecksteil von Bierautomat.
Nein, wir reißen nicht gleich eine Büchse auf. Wir haben von unseren Eltern Erziehung genossen und eilen in unsere Herberge. Dort auf den Balkon geht es: Zisch Nr.1, Zisch Nr.2, 3 und 4 folgen schnell. Rettung in der letzten Minute.
Abschweifung Ende
Hoch, hoch, hoch... Endlich mal wieder bergauf. Fröhlich plaudernd hüpfe ich voraus. Mein Begleiter fällt zurück. Schweigt, antwortet nicht auf meine Fragen. Naja, was plappere ich auch so dämlich vor mich hin.
„100“, ruft Robert plötzlich und ist wieder bereit, sich am Gespräch zu beteiligen.
„Was 100?“ frage ich leicht genervt.
„Ich zähle immer bis 100. Jeden Schritt und schaue dabei nur auf meine Füße. Nach 100 Schritten schaue ich auf und stelle erfreut fest, schon wieder ist der Gipfel ein Stück näher gekommen.“ Naja, wenn es hilft.
Wir erklimmen den Hausruck. Ein Mittelgebirge im Alpenvorland. Seit Tagen mal wieder etwas Wald, eher Forst. Schöne Waldwege, weite Ausblicke. Erzgebirge, Siebengebirge, Böhmerwald… wir werden erinnert. Die Wolken hängen tief, aber es ist nicht kalt und windstill. Es macht Freude unterwegs zu sein. Die Kalkalpen rücken näher. Noch zwei Tagesmärsche und wir sind mittendrin. Gestern Abend haben wir wieder eine sehr vernünftige Entscheidung getroffen. Unser nächstes Zwischenziel ist Bad Ischl. Die Recherche ergibt zwei Möglichkeiten. 48 km und 2200 Höhenmeter, „ausgesetzte Passagen, seilgesichert, absolute Trittsicherheit erforderlich“, warnt die Wanderapp.
Da juckt es mir in den Füssen, da würde ich gerne hin. Träume von den Aussichten und dem Gefühl oberhalb der Baumgrenze zu sein. Die Alternative: 50 km und 410 Höhenmeter. Immer entlang am Ufer des Traunsees, irgendwo zwischen Straße und Eisenbahn. Wir überlegen nicht lange. Nehmen die zweite Variante. Wir sind schließlich nicht eine Woche auf Hüttentour, sondern auf Wanderschaft. Außerdem liegt da oben noch Schnee und ich habe zwar Badelatschen im Gepäck, aber keine Steigeisen. Ein bisschen Wehmut bleibt. Gegen 17 Uhr kommen wir in Vöcklabruck an, dem Tor zum Salzkammergut.

01.05.2023
33. Etappe
Von Lamprechten nach Eberschwang

„Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür, uuhuhuh.“ Massen tanzen, hüpfen, grölen. Diskobeleuchtung. Noch mit Schlaf in den Augen starre ich mit zugekniffenen, altersweitsichtigen Augen auf das kleine Display meines Telefons. Um 01:42 Uhr kam dieses Filmchen in Form einer WhatsApp Nachricht vom Bürgermeister aus Pinnow. Gestern war auf dem Flugplatz „Tanz in den Mai“. Die Gemeinde hat diesen Schwoof organisiert. Unsere Aufgabe war es, die Flugzeughalle besenrein zu übergeben. Keine leichte Aufgabe. Fünf Flugzeuge mussten raus. Auseinandergenommen, verstaut, weggeflogen. Und der Dreck aus den Ecken.
Das Telefon stand nicht still in den letzten Tagen. Der und der braucht einen Schlüssel, Wasseranschluss, Starkstrom, werden genügend Leute da sein zum Abrüsten der Flugzeuge . Ein wenig hilflos fühle ich mich, tue was ich kann aus der Entfernung, werde nervös.
Nun ist es geschafft. Das Fest war ein Erfolg, 540 Gäste. Die Leute im Verein haben auf lobenswerte Art zusammengearbeitet. Wie konnte ich zweifeln. Ob ich es wohl je lernen werde?
Schon 7:30 Uhr brechen wir auf. Wieder mal ohne Kaffee und ohne Frühstück. In Österreich ist Feiertag und zwar so richtig. Absolut alles ist zu. Die Tour gleicht der gestrigen. Kleine Sträßchen, hügelige Landschaft, prächtige, gepflegte Höfe, freundliche Menschen und jede Menge Frühling. Nichts stört den Seelenfrieden. Sollten wir uns damit zufrieden geben?
„Robert, was wissen wir eigentlich über Österreich?“
Es bleibt lange still neben mir. Robert kramt in seinem Gedächtnis und findet nichts nennenswertes.
„Robert, über die Tschechen wissen wir mehr als über die Österreicher. Vielleicht, weil sie im selben System gelebt haben wie wir?“
Eins kommt Robert in den Sinn. Die Österreicher haben sich mehr oder weniger freiwillig und widerstandslos an Nazideutschland angliedern lassen. Wir hören gerade das Hörbuch „Die Welt von gestern“ von Stefan Zweig, wenn wir mal dazu kommen. Vielleicht bekommen wir ein paar Antworten auf Fragen, die wir eigentlich gar nicht haben. Wir werden das Haar in der Suppe schon noch finden. Sind ja auch noch eine Weile hier. Eine neue Bekanntschaft haben wir gemacht. Der Kiebitz auf dem Weg in den Norden. Ulkig sieht er aus mit seinen paddelartigen Flügeln und dem Häubchen auf dem Kopf. Sein Ruf begleitet uns den ganzen Tag. Und noch etwas, was ich bisher nicht kannte: In jeder feuchten Senke sitzt ein Rebhuhn und schlägt schrill, metallisch Alarm, wenn wir uns nähern.
„Robert, wäre das nicht etwas fürs Abendbrot? Heute hat doch alles zu?“

30.04.2023
32. Etappe
Von Schärding nach Lamprechten

„Wenn´s draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein.“ Ein Evergreen von Manfred Krug. Gestern Abend haben wir getanzt. Zwischen Bett, Schrank und Tisch war gerade genug Platz.
Weingartl rot und Weingartl weiß sind uns wohl erst zu Kopf gestiegen und dann weiter ins Bein abgesunken. Beide Flaschen waren am Ende leer. Heute Morgen habe ich eine davon heimlich entsorgt. Was soll denn die Wirtin denken. Zumindest gab es keine Beschwerden aus den Nachbarzimmern.
Aber was soll man anders tun, als den Frühling zu feiern.
„Wenn der weiße Flieder wieder blüht“, „Veronika der Lenz ist da“, „ Der Frühling zündet die Kerzen an“. Summend spaziere ich durch die Landschaft. Zartestes Grün, blühender Raps, Wiesen übervoll mit Löwenzahn, duftende Blüten in lila-weiß Schattierungen, gelbe und rote Tulpen setzen farbliche Akzente.
Seit 50 Jahren bin ich Teil dieser kraftvollen, überschwänglichen, stillen Explosion des monatelang Ruhenden, Erstarrten. Immer wieder durchlebe ich die Freude als wäre es das erste Mal. Ein Gefühl, welches sich nicht abnutzt. Im Gegenteil, es wird von Jahr zu Jahr intensiver.
Kurz folgten wir noch dem Innradweg, dann zweigt dieser ab nach Westen. Wir gehen querfeldein, wollen mehr nach Süden. Wir haben wieder unsere Ruhe. Nachdem wir wochenlang kaum auf einer Bank sitzen konnten, weil diese nass und kalt war, hatten wir gestern Mühe, eine Sonnenbank zu finden, die nicht besetzt war. Der Weg entlang des Inns ist eine der touristischen Hauptrouten und beim ersten Sonnenschein ist dort Massenbetrieb. Nun sind wir wieder für uns. Gehen einsam durch hügelige Landschaft über schmale Strässchen. Wir bewundern schöne Bauernhöfe und beschauliche Dörfer. Der Maibaum steht. Es gibt kaum Wald und der Blick kann schweifen. Hinter uns der Böhmerwald. Immer wieder schauen wir zurück und erinnern uns. „Robert, weißt Du noch, wie wir nach stundenlangem Aufstieg endlich den Spitzbergpass oberhalb Železná Ruda erreichten? Es hat geregnet und es waren fünf Grad!“ Das Gebirge verblasst immer mehr, die Erinnerungen sicher nicht. Vor uns tauchen am Horizont die nördlichen Kalkalpen auf. Ein 600 km breiter Gebirgszug, der den eigentlichen Alpen vorgelagert ist. Die höchsten Gipfel sind um die 2000 m hoch. 60 km Luftlinie bis dorthin. In 3-4 Tagen haben wir sie erreicht. Ich freue mich darauf.
Ich fühle mich wohl in Österreich. Das ist auch einem kleinen, aber für mich nicht unwichtigem Detail geschuldet. Hier gibt es keine Gartenzäune.

29.04.2023
31. Etappe
Von Passau nach Schärding

Kleine Robertsche Abschweifung 6
Die Hammerschmiede, irgendwo gelegen zwischen dem Böhmerwald und Passau am Fluss Ilz, der schwarzen Perle des Bayerischen Waldes.
Wir sitzen im urigen Gastraum unserer Herberge. Sechs Bankreihen zu je vier Plätzen, drei lange Tische dazwischen. Hier haben locker 24 Gäste Platz. An einem weiteren Tisch diesen Formates sitzen wir und beobachten gespannt die Szenerie. Viel verstehen können wir nicht, der Dialekt ist ungewohnt. Doch langsam kristallisieren sich Gesprächsfetzen heraus. Ein Männersextett im mittleren Alter, etwas triefäugig, mit dem Hang zum Schmerbauch freut sich, dass wieder Biber geschossen werden dürfen. Tatsächlich haben wir am Fluss einige Knabberspuren erkennen können. Und nicht nur junge Ulmen, sondern auch ausgewachsene Buchen am Ufer mussten dran glauben. Respekt, Herr und Frau Biber!
„Ja und der Wolf“, belauschen wir weiter das Gespräch. „Das wird nun höchste Zeit, dass da eingegriffen wird. Die machen ja alles kaputt, fressen alle Tiere weg und
man kann ja kaum noch die Kinder…“ Tatsächlich haben wir in der Passauer Lokalpresse gelesen, dass ein Wolf zwei altersschwache Schafe gerissen hat. Die standen seit zehn Jahren an einem Hang und
fraßen ihr Gnadengras. Zäune konnte man nur schwer hinstellen, an einen Schutzhund gar nicht zu denken. Ja, gegen den Wolf will man nichts sagen, aber wir fordern schon, dass man seine Tiere
sicher draußen auf der Weide stehen lassen kann.
Gut, ich lebe nicht in dieser Region und will mich nicht schlaumeierisch aus dem Fenster lehnen. Aber wo bleibt die Verhältnismäßigkeit? Wir sehen einen Sattelschlepper nach dem anderen, der Baumstämme Richtung Autobahn transportiert. Ganze Hänge werden gerodet, was wohl – zur Entschuldigung – auch dem Borkenkäfer geschuldet ist. Aber was treibt im Vergleich der kleine dicke Biber? Warum gönnt man ihm sein Futter nicht? Ähnlich beim Wolf. Hunderte Schlachttiere verlassen täglich die Region zu einem fern gelegenen Schlachthof, aber alle regen sich auf, über den artgerechten Tod der beiden Wollträgerveteranen. Kämen sie in die Wurst, wäre das kein Problem.
An allen Tischen wird gezockt oder gewürfelt. Nebenan spielen vier Alt-Ossis Doppelkopf. Wir verstehen den sächsisch-thüringischen Akzent und kennen die Spielregeln. Dulle über der Alten, Farbsolo, Fuchs gefangen – wir könnten gleich einsteigen. Wollen wir uns anfreunden mit denen? Eher weniger! Das anfangs erwähnte Männersextett spricht nun weiter über Politik. Wir erhaschen nur Wortbrocken. Vom „Tag der Einheit“ ist die Rede, der hierzulande als „Tag der Gemeinheit“ zelebriert wird. Alle trinken fleißig und die Lautstärke ist enorm. Was fehlt ist der Tabakqualm, der früher ganz sicher dick unter der Decke hing. Morgens sind dann all die fetten SUV vor der Tür verschwunden. Alkohol? Hier doch nicht!
Der etwas schmierige Wirt setzt sich an unseren Tisch. Vom Wetter ist die Rede, Wetter geht immer. Später lese ich im Netz in einem Kommentar eines Gastes, dass dieser Wirt kaum in der Lage ist, seine rassistischen Sprüche wenigstens halblaut von sich zu geben. Wie gesagt, bei uns war vom elenden Aprilwetter die Rede, ansonsten war das Essen spitze. Dank seiner quirligen, freundlichen Frau, die aus dem Böhmischen stammt.
Über das Wahlverhalten in dieser Region hatten wir unsere Vorurteile, die sich aber durch kurzes Nachschlagen bestätigen: Die CSU mit knapp 40 %, gefolgt von einer ebenso finsteren Truppe – „Freies Schussfeld für freie Jäger“ oder so ähnlich.
Morgen geht’s nach Passau. SPD-Bürgermeister und 12000 Studenten. Da sind wir diesen Mief hoffentlich los.
Abschweifung Ende
Heute haben wir Deutschland zum zweiten Mal verlassen. Diesmal aber nun wirklich. Nach Leipzig, Karlsbad und Passau ist nun Villach unser nächstes Zwischenziel. 350 km durch Österreich liegen vor uns. Wir sind dem Inn an seinem Westufer in Richtung Süden gefolgt, da waren wir noch in Deutschland. Dann irgendwann, zack, links ab, auf einer wunderschönen, filigranen, etwas schwankenden Brücke den Fluss überquert und schwupp sind wir in Österreich. Kein Schild, nicht mal ein umgestürztes, kein Wappen, kein Nichts. Dass wir nun in einem anderen Land sind, das wissen wir nur aus unserer Landkarte. Aber halt! Robert! Stopp!
„Lies mal, was da auf dem Schild steht.“
Wir lesen: Radfahrer absitzen, Achtung Stiege. In Deutschland hätte es geheißen: Radfahrer absteigen, Achtung Treppe. Der erste Beweis. Wenige 100 m später werden aus Anwohnern Anrainer. Der nächste Beweis. In Schärding wird es dann unübersehbar. Auf dem Marktplatz findet ein Volksfest statt. Die Polizei präsentiert das Können ihrer Hundestaffel. Jahrmarktstimmung. Überfälle werden simuliert, Schüsse knallen, das Schärdinger Baumgartenbier fließt in Strömen und die dicken Kinder werden mit Eis und Cola ruhig gestellt. Die Polizisten sind wie ihre Köter bewaffnet bis an die Zähne, genau wie ihre deutschen Kollegen. Nur tragen sie eine andere Uniform und eine sehr fesche Schirmmütze.
Die Entdeckung des Tages: Weingartl rot und Weingartl weiß. Österreichischer Tafelwein, gibt es beim Austria- Lidl. Schmeckt nicht mal halb so schlecht, wie der doppelt so teure in Germanien.
28.04.2023 Verschnaufpause
Gestern Abend sind wir in Passau angekommen. Glücklich, beseelt, erschöpft, ein wenig euphorisch ob unserer Heldentaten. Für uns sind 28 km eine Höchstleistung. Auf uns wartet eine heiße Dusche, eine Tiefkühlpizza, ein Glas Rotwein. Alles schnell noch organisiert im Netto auf der anderen Straßenseite.
Keine Tourenplanung, kein Quartiermachen, keine Wetterbeobachtung, kein Vorausdenken. Wir gönnen uns einen Ruhetag.
Wir haben unser Zimmer über Airbnb gefunden und es ist noch das, womit diese Plattform einst geworben hat. Ein junger Mann, wahrscheinlich viel auf Reisen, lebt mit seinem Rehpinscher Rocky in einer sehr noblen, aber für einen Menschen viel zu großen Wohnung am Stadtrand. Ein ständiger Untermieter ist ihm zu viel und so vermietet er ein Zimmer auf Tage an Gäste der Stadt. Küche und Bad teilen wir uns. Eine WG für 48 Stunden.
Matthias ist ein sehr netter Mensch, Rocky eine Wucht. Kaum ist sein Herrchen für zwei Stunden aus dem Haus, sitzt der kleine Feger bei uns im Bett. Mal sitzt er bei Robert auf dem Schoß, mal kuschelt er sich an mich. Manchmal spielt der 20 cm hohe Kleinsthund mit Segelohren Wolf. Streckt theatralisch das schwarze Näschchen in den Himmel und heult herzzerreißend. Er vermisst seinen Erziehungsbeauftragten. Da wird selbst Robert, der hartgesottene Realist, windelweich und bekommt einen verträumten Gesichtsausdruck während er Rocky den Nacken grault.
Den verregneten, aber milden Tag verbringen wir zum größten Teil auf der Veste Oberhaus, eine der größten und imposantesten Burganlagen Europas. Der Grundstein dafür wurde bereits 1219 gelegt. Es ist nicht ganz leicht, aber ich schwatze Robert die 5 Euro Eintritt für das Burgmuseum ab. Wir bewegen uns langsam durch die gut gestaltete Ausstellung. Erfahren eine Menge Neues und vertiefen unser Wissen, welches wir in den letzten Wochen erworben haben. Geht es um die Handelswege nach Böhmen, Bayern und Österreich halten wir uns länger auf. Salz wurde von Säumern über den Goldsteig nach Böhmen geschafft. Auf dem Rückweg trugen ihre Lasttiere böhmisches Getreide, welches von Passau die Donau aufwärts nach Regensburg getreidelt wurde. Das dritte wertvolle Gut war der österreichische Wein. Auf dem Goldsteig sind wir die letzten Tage immer wieder gewandert. Ich stelle mir vor, was vor vielen hundert Jahren auf diesem Weg wohl los gewesen sein mochte. Ebenfalls länger halten wir uns auf in der Etage, in der es um mittelalterliche Burgen geht. Detailliert ist beschrieben, warum so eine Burg entstand (es ging um Status und Macht), wie sie entstand (jedes Gewerk ist aufgeführt vom Zimmermann bis zum Steinmetz), wie es sich in so einem Kasten lebte (kalt, dunkel, langweilig – abgesehen von wüsten Fressgelagen, die man sich hin und wieder gönnte) und wer so alles auf einer Burg lebte (eine kleine Stadt inkl. medizinischem Personal und Prostituierten).
Die Abteilung mit dem unvermeidlichen Kirchengedöns durchfliegen wir nur hastig. „Robert, wir sind Banausen“, flüstere ich leise, damit es die Museumsaufsicht nicht hört. Wir wissen, dass wir uns damit beschäftigen müssten.
Passau war zu Zeiten der Fürstbischöfe ein bedeutendes Herrschafts- und Handelszentrum und prachtvolle Residenzstadt. Die Bischöfe von Passau waren nicht nur die geistlichen, sondern auch die weltlichen Herrscher über die Dreiflüssestadt. Fast 600 Jahre lang demonstrierten sie Macht und Stärke. Die Passauer Bürger rebellierten immer wieder gegen die bischöfliche Herrschaft im Kampf um mehr Unabhängigkeit. Doch alle Angriffe verliefen ergebnislos.
Robert grummelt: „Immer dasselbe. So eine Drecksbande.“ Besser hätte ich es nicht auf den Punkt bringen können.
Als wir gegen 15 Uhr das Museum verlassen, regnet es immer noch. Wir trinken einen Cappuccino im Schloßkaffee mit Panoramablick. Wir schauen hinab auf die Altstadt und die drei Flüsse. Eigentlich ist das ein farbenprächtiges Ereigniss. Die schwarze Ilz, der grüne Inn und die braunblaue Donau fließen ineinander und es dauert eine Weile, bis sich alles vermischt. Die Betonung liegt auf eigentlich. Heute ist alles grau. Macht nichts.
Wir schlendern noch eine Weile durch die Altstadt. Es hat aufgehört zu regnen. Robert wünscht sich eine Busfahrt in unser Quartier. Mein lieber Ehemann schwächelt heute ein wenig. Hat Kopf und Rücken. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass er gestern seinen Rentenausweis zugeschickt bekommen hat.

27.04.2023
30. Etappe
Von Schneidermühle nach Passau

28 km sind wir heute gelaufen. 28 km. Unvorstellbar. Wir sitzen in einem kleinen Stadtpark in einem Vorort von Passau auf einer Bank. Ich habe mir ein kleines Fläschchen Sekt gegönnt, ein Piccolöchen und Robert zischt ein Bier. 28 km. Ich schüttele innerlich den Kopf. Unsere Bank steht am Rand eines Spielplatzes. Vor uns spielen zwei Jungs, vielleicht fünf Jahre alt, im Sandkasten. Etwas verschämt verberge ich meine kleine grüne Flasche. Wie sieht das denn aus? Mit der Pulle auf der Parkbank und vor uns die spielenden Kinder. 28 km und es war einfach, unkompliziert, sonnig, schön. Wie der Lohn für durchlebte Mühsahl.
Den ganzen Tag folgen wir der Ilz – die kennen wir schon von gestern. Fast eine gute Bekannte. Weil die Ilz Hochmoore und Fichtenwälder durchfließt, ist ihr Wasser bräunlich bis schwärzlich gefärbt. Ihr Kosename: die schwarze Perle. Ihr Wasser ist weich, da es kristalline Gneise und Granite durchsickert.
Der Gesteinswechsel zwischen Granit und Gneis ist auch die Ursache für das Entstehen eindrucksvoller Schluchten. Die bewundern wir heute ausgiebig. Während wir im Tal der Zschopau die Ausbeutung des Flusses durch Industriebauten auf beiden Seiten des Ufers erleben durften, lernen wir heute Neues kennen. Es ist unsichtbarer, hat weniger Spuren hinterlassen, zumindest auf den ersten Blick… die Trift.
Weil Holz ein sperriges Transportgut ist, war in der vormotorisierten Zeit der Wasserweg die einzige Möglichkeit, Brenn- und Bauholz über große Distanzen zu transportieren. Wird das Holz ungebündelt auf dem Wasserweg verfrachtet, spricht man von Trift, werden Stämme zusammengebunden, spricht man von Flößerei. Geflößt wurde aber nur auf den größeren Flüssen wie Main, Isar oder Donau.
Den im 18. Jahrhundert noch unbesiedelten und holzreichen Höhenzügen des Bayerischen Waldes lagen die bevölkerungsreichen Städte auf den fruchtbaren, aber waldarmen Böden des Donautales zu Füßen. Was lag also näher, als einen Ausgleich zwischen Überschussgebiet und Mangelregion zu schaffen? Weil mit einer solchen Ressourcenverschiebung ein Geschäft zu machen ist, begann man ab dem 18. Jahrhundert, die Gewässer der oberen Ilz triftmäßig auszubauen.
Das Wasser der Bäche und Flüsse wurde gefasst, der Ausbau immer mehr in den Bayerischen Wald hineingetrieben. Bäche wurden bis zu den Einschlagsorten ausgebaut und dazwischen Querkanäle errichtet, um möglichst viel Wasser zu fassen. In Hochzeiten gab es hier ein Triftstraßensystem von 230 km Länge. Das Holz wurde im Sommer geschlagen und während der Schneeschmelze über die dann wasserreichen Flüsse zu Tal befördert. Für die Trift vom Inneren Bayerischen Wald bis nach Passau war mit etwa sechs Wochen zu rechnen.
An der Ilzmündung bei Passau wurde das Holz mit einem quer zum Fluss schwimmenden Rechen aufgefangen. Während der Triftsaison zogen bis zu 500 Arbeiter die Scheite aus dem Wasser und luden es auf Lastkähne, die das nasse Holz zum Trocken zu Holzhöfen brachten. Das trockene Holz wurde dann erneut auf Schiffe verladen und donauabwärts in die großen Städte Österreichs transportiert. Um 1775 wurden so jährlich an die 20.000 Klafter Brennholz von Passau nach Wien verschifft. (Eigentlich weiß ich gar nicht so genau, was und wieviel ein Klafter ist. Da muss ich nocheinmal nachlesen.)
Ein Stück laufen wir auf dem Gleisbett der Ilztalbahn. Eine jetzt rein touristische Attraktion, im Ehrenamt betrieben. Sie fährt erst ab Mitte Mai und dann nur am Wochenende. Sollten wir uns im Monat irren, dann sicher nicht auch noch im Tag. Heute ist Donnerstag, der 27. April. Heute kommt ganz sicher kein Zug. Es ist lustig, so zu gehen. Die einzelnen Schwellen sind zu nah aneinander – tipp tipp tipp – machen wir. Auf jede zweite zu treten ist zu weit – taap taap taap – machen wir. Ich beginne, auf der Schiene zu balancieren und reiche Robert elegant meine Hand von oben herab. Ich brauche Unterstützung. Dieses Angebot kann er nicht ablehnen. So stolziere ich also dahin und neben mir macht es tipp tipp taap taap tipp tipp tipp taap taap. Ein skurriles Pärchen. Gut, daß uns keiner beobachtet.
Wir machen viele Pausen. Sitzen in der Sonne. Gehen weiter. Haben keine Eile. Wir gehen fast stetig bergab. Wir gehen in den Frühling. Wie schön das ist.

26.04.2023
29. Etappe
Von Langdorf nach Schneidermühle

Nachtgespenster
Ich liege fest, warm und sicher unter meiner Decke. Robert, dicht neben mir, atmet ruhig und tief. Er schläft bereits. Der Glückliche. Ich schmiege mich an. Unser Zimmer ist klein, das Bett füllt fast den ganzen Raum. Die gesamte Ostseite öffnet sich durch ein großes Fenster. Vor drei Stunden noch bestaunte ich das Panorama, das sich mir darbot. Wald, Wiese, die gegenüberliegende Seite der Schlucht. Alles in Draufsicht. Wir thronen ganz oben. Unter uns fällt das Gelände ab. Nun ist es Nacht und durch die besprosste Öffnung der Wand fällt nur noch ein fahler Schimmer.
Dunkle Gedanken kriechen wie Nebel herein. Nachtgespenster. Oft gefroren, oft gehadert, oft gesorgt, mitunter geängstigt. Zuviel scheinbare Verantwortung. Bunker am Wegesrand, Geschichten von Vertreibung, von Krieg, von Konzentrations- und Arbeitslagern, von Umweltskandalen – von der ganzen unverständlichen Unvernunft des Menschseins, von der eigenen Unzulänglichkeit an allen Ecken und Enden. So viele Fragen offen. Die Wahrheit scheint unerreichbar.
All die lichten, sonnigen Momente. Die Freude am Unterwegssein, die Leichtigkeit, die berührenden Begegnungen mit den schönsten Seiten der Gattung Mensch – jeden Tag erleben wir sie erneut, sie sind nicht vergessen. Sie wirken nur, wie durch ein umgedrehtes Fernglas. Am Werk sind die Nachtgespenster.
Wer hat behauptet, dass dies ein Spaziergang wird? Kann der richtige Weg, der Weg des geringsten Widerstandes sein? Mich überkommt der Trotz. Es gibt kein Zurück. Ein überaus tröstlicher Gedanke bricht sich Bahn und ich nehme ihn mit in den Schlaf. Der erste Weg des Menschen auf die Welt ist ja nun wirklich kein Weg ohne Widerstände. Warum sollte sich am Grundprinzip etwas ändern.
Geweckt werde ich gegen 7:00 Uhr von der aufgehenden Sonne. Sie scheint mir direkt und etwas unverschämt ins Gesicht. Ich bin beschämt. Wie konnte ich hadern, wie konnte ich zweifeln. Raus aus den Federn. Weiter geht es. Vor uns liegen knapp 25 km. Das Wetter ist frostig, aber stabil. Fix alles zusammengeräumt. Frühstück, Kaffee, Zeitunglesen – alles fällt aus. Ein Glas kaltes Leitungswasser, ein Blick auf die Route und los geht es.
Alles verläuft, wie in Urlaubsprospekten angekündigt. Breite Forstwege zum zügigen Ausschreiten, alte Hohlwege zum Träumen, wurzelige Pfade zum Klettern, tiefe Schluchten zum Staunen, lichtdurchflutete Wiesentäler zum Entspannen, phantasievolle Felsformationen zum Bewundern, Sonnenbänke zum Verweilen. Wir durchwandern das Tal der Ilz. Landschaftlich überaus reizvoll, touristisch hoch erschlossen. Heute menschenleer. Was für ein Glück.

25.04.2023
28. Etappe
Von Frauenau nach Langdorf

Jeder Tag bringt Überraschungen, Unerwartetes, Nichtvorhergesehenes. Man muss sich darauf einlassen. Und das ist gar nicht so einfach, als durch und durch organisierter Mensch, der ich nun mal bin. Zuhause steht beim Morgenkaffee weitgehend fest, wie der Tag verlaufen wird. Am Sonntagabend nimmt die kommende Woche Gestalt an und am Jahresanfang steht zumindest die Urlaubsplanung. In unserem jetzigen Leben legen wir am Abend eine Tour fest und buchen eine Übernachtung – was uns unterwegs begegnet, ist unklar. Wir laufen jeden Tag ins Ungewisse.
Und in diesem Sinne begann auch schon der Morgen. Wir haben endlich für Robert eine neue Jacke gekauft. Seitdem er in Burg vor x Tagen versucht hat, einen von mir durch das Spirituskocherchen entfachten Brand zu löschen und zwar mit seiner Jacke – ich wusste gleich, das ist eine blöde Idee, hatte aber keine bessere und habe nur hilflos im „langen Hänger“ daneben gestanden –, läuft er mit einem unübersehbaren Brandloch auf dem Rücken durchs Leben. Und zwar durchs öffentliche. Das ist mir, unter uns gesagt, peinlich.
In Karlsbad habe ich ihn in die SpoWa gezerrt, um dem Spuk ein Ende zu machen. Widerwillig ist er mir gefolgt, er hängt sehr an diesem 20 Jahre alten Kleidungsstück und hat die Latte so hoch gehängt, dass es unmöglich schien, ein neues zu bekommen. Es muss Innentaschen haben und zwar 2 Stück. In Worten „zwei“. Finde das erst mal. Dann muss sie warm sein. OK. Da gehe ich mit. Und zu guter Letzt muss sie auch noch billig sein. Es war klar. Wir mussten scheitern.
Aber zurück zu heute morgen. Der Tag begann zäh. 5 Grad und die dunkelgraue Unterseite der Wolken zum Greifen nah. In unserer Pension gab es kein Frühstück und auch kein warmes Getränk, so war unser erster Gang runter in die Stadt und irgendwo einen Kaffee trinken. In Frauenau, geprägt von Wallfahrt, Wald und Glas, leben etwa 2500 Menschen. Es gibt drei Bäcker. Sie öffnen um 5:30 und schließen um 11:00. Dort gibt es nur Brot und Brötchen und Kaffee zum Mitnehmen im Pappbecher mit Plastikdeckel. Dann gibt es zwei Metzgereien mit Imbiss. Dort könnte man sich hinsetzen. Es gibt aber keinen Kaffee.
Wir machen einen Kompromiss. Ich gehe in die Bäckerei und kaufe zwei Kaffee. Ohne Plastikdeckel. Robert holt in der Fleischerei zwei Brötchen mit warmem Leberkäse. Dann sitzen wir auf einer etwas feuchten Bank und mümmeln unsere Brötchen. Und während ich mich innerlich bei der armen Sau entschuldige, die ich gerade mit Hochgenuss verzehre, fällt mein Blick auf das Lädchen auf der anderen Straßenseite. „Skiverleih“ steht da und „Wanderbekleidung“ und „20 Prozent Rabatt auf Alles“. Vor der Tür baumeln Jacken an Ständern. Die sehen gut aus. Warm jedenfalls. Da muss ich hin. Robert windet sich, aber es gibt kein Vertun. Ein prüfender Blick genügt. Sie haben alle 2 Innentaschen. In Worten zwei. Sie sind warm UND sie sind unschlagbar günstig. Robert versucht es noch einmal. Seine alte Jacke hatte zwei Innentaschen und jede war nochmal unterteilt. Papperlapapp. Jetzt schlage ich zu. Nach 15 Minuten kommt Robert mit einer neuen Jacke aus dem Laden. Wie gut er aussieht. Ich himmele ihn ein wenig an. Aber nur aus den Augenwinkeln. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir hier eine neue Jacke finden.
Jetzt könnte ich aufhören zu schreiben, das wäre ein guter Schlusssatz, aber es erwartet uns noch mehr Unvorhersehbares, was Beachtung verlangt. Wir laufen los. Vor uns lächerliche 15 km. Ein Spaziergang. Nach drei Kilometern angenehmer Steigung machen wir eine kleine Rast. Die Sonne scheint warm, Robert zieht die neue Jacken aus. Ich bin noch skeptisch. Einen Kilometer später. Robert zieht die neue Jacke wieder an, es beginnt zu tropfen. Weitere zwei Kilometer später. Wir stehen frierend und durchnässt in einem kleinen Wartehäuschen am Bedarfshaltepunkt Klingenbrunn. Hier hält, bei Bedarf, in großen Abständen die Waldbahn, die zwischen Zwiesel und Grafenau verkehrt. Es regnet, es hagelt, es stürmt und die nächste Bahn fährt in 15 Minuten. „Robert, das ist ein Bedarfshaltepunkt. Ich habe Bedarf. Wenn ich nicht bald ins Warme komme, werde ich krank und wir haben nichts gekonnt.“ Wir sind uns einig. Wenn es beim Eintreffen des Zuges nicht aufgehört hat zu regnen, dann steigen wir ein.
Wir steigen ein. 6 km kosten 3,20 Euro. Fünf Minuten später, am Bahnhof Spiegelau, spuckt uns das Bähnchen wieder aus und wir kehren ein, um uns aufzuwärmen. Ich bin froh, dass wir nicht ehrgeizig und nicht verbissen sind. Sondern vernünftige Menschen. Nun sind es nur noch 3 km und sie sind ein Geschenk. Die tosenden Wasser der großen Ohe haben eine tiefe Felsschlucht erschaffen. Staunend gehen wir durch die Steinklamm nach Langdorf. Hier bleiben wir heute Nacht. Die Auswertung unserer Navigationsapp ergibt: Durchschnittsgeschwindigkeit 6,2 km pro Stunde. So schnell waren wir, aufgrund der Zugfahrt, noch nie.

24.04.2023
27. Etappe
Von Železná Ruda nach Frauenau

Heute verlassen wir Tschechien. Wir sind zwar schon früh wach, bummeln aber rum. Der verdammte Regen. Kalter, nasser Gebirgsregen. Ich krieche noch einmal unter meine dicke Zudecke (heute mit Tigerbettwäsche) und führe innerlich Statistik. Vor genau vier Wochen haben wir Schwerin verlassen. Unser gemütliches Bett, unseren gemütlichen Laden, unser gemütliches Leben. Seitdem erinnere ich mich, und ich erinnere mich ganz genau, an vier Sonnentage. Den ersten noch an der Elbe. Einen im Zschopautal. Da haben wir Rast gemacht an einer schönen Brücke. Man konnte auf der Wiese sitzen und die Schuhe ausziehen. In Konstantinovy Lázně haben wir im Biergarten gesessen und vorgestern war Frühsommer. Ansonsten sind wir täglich ohne Ausnahme durch kalten, nassen Regen gelaufen. Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad. „Robert“, frage ich meinen noch leise vor sich hin schnarchenden Bettgefährten, „was haben wir uns da ausgesucht? Wer stellt uns da auf die Probe?“ Antwort bekomme ich keine. Zu Recht. Was stelle ich auch für unsinnige Fragen.
Gegen 9 starten wir. Wir decken uns im örtlichen, wie fast überall von Asiaten geführten Krämerladen ein, mit allem was uns während der letzten 14 Etappen vertraut geworden ist. Unsere Ration Hörnchen, ein Käse-Eckchen für mich, für Robert eine rosarote Dauerwurst mit Fettgrieben, einem Apfel und zwei Stück Fidorka, die handtellergroße runde Waffelspezialität. Damit sind wir die letzten zwei Wochen über den Tag gekommen und so wird es auch heute sein. Zum letzten Mal.
Unser Weg wird lang, strapaziös, dabei ungeheuer interessant und vielfältig. Zunächst bewegen wir uns durch ehemaliges Grenzgebiet. Auch hier hing der Eiserne Vorhang tief und teilte Europa in zwei Lager. Viele, viele Tafeln am Wegesrand informieren zweisprachig über Grenzsicherheitsanlagen, Bunker, Schießanlagen, Panzerabwehrgräben und den Umgang mit Flüchtenden. Gäbe es die Informationen nicht, würde man nur bei genauem Hinsehen Überreste dieser menschenunwürdigen Gefängnismauern ahnen. Gut, dass wir erinnert werden. Gut, das wir nicht vergessen dürfen.
Wenig später grüßt der schwarze Bundesadler – oder ist es doch ein Pleitegeier? Aus Šumava wird der Bayerische Wald. Ein bescheidenes Schild liegt umgefallen in der Matsche. „Landesgrenze“, lesen wir darauf. Wir überschreiten diese Mini-Grenze und finden, dass es so besser als früher ist. Viel besser. Wirklich gut? Darüber muss ich erst noch nachdenken.
Wir laufen durch ein idyllisches Bergdörfchen. Wenn bloß der verdammte Regen nicht wäre. Wunderhübsch bemalte Häuser mit Holzschindeln, Balkone mit geschnitzten Geländern. Ein tiptop asphaltiertes Sträßchen, gepflegte Vorgärten, glänzende Karossen unter den Carports. Die dezenten Schmuddelecken hinter den Häusern, der kläffende Hofhund an der Kette, das Improvisierte, das Halbfertige, das Urige – alles verschwunden. Wir sind zurück in Deutschland. Geschniegelt, gebügelt, geleckt. Alles vom Feinsten. Der Wohlstand lässt grüßen.
Der weitere Weg ist eine Lust. Im Nationalpark, den wir jetzt durchstreifen, gönnen sich die Bayern einen Urwald. Wie anders es ist als in einem lausigen Forst, den wir ja für Wald halten. Umgestürzte, vermodernde Bäume recken ihre schwarzen, krumpeligen Wurzelballen empor. Alles ist bemoost. Wir gehen auf schmalem Pfad durch eine unwirkliche Märchenlandschaft. Wenn uns jetzt Rotkäppchen mit Kuchen und Wein auf dem Weg zur Großmutter entgegenkäme – wir würden uns nicht wundern.
Unser Ankommen in Deutschland wird uns leicht gemacht. Bayern ist ja auch nicht wirklich Deutschland. Wenn unsere Pensionswirtin loslegt, dann verstehe ich kein Wort. Ehrlich. Für 40 Euro (das ist fast der Rekord nach unten) finden wir ein schönes Doppelzimmer unterm Dach und werden herzlichst empfangen.
23 km sind wir heute gelaufen und es war eine schöne Tour – wenn bloß der Regen nicht gewesen wäre.

23.04.2023
26. Etappe
Von Zelená Lhota nach Železná Ruda

Heute ist Abschlussabend. Und wie es sich gehört, begehen wir diesen zünftig, mit einem Restaurantbesuch.
Morgen verlassen wir Tschechien. Ostrov, Karlovy Vary, Stružná, Žlutice, Nečtiny, Konstantinovy Lázně, Mezholezy, Horšovský Týn, Mrákov, Chudenín, Zelená Lhota und heute schließlich Železná Ruda. Alle diese Städte, Dörfer, Orte lagen auf unserem Weg von Norden nach Süden durch dieses durch und durch sympathische Land. Mit jedem dieser Namen verbinden wir nun eine Begebenheit, eine kleine Geschichte. Wir sind durch bezaubernde Landschaften gewandert, haben viel Neues, uns bis dahin Unbekanntes erfahren und haben durchweg freundliche, hilfsbereite Menschen getroffen. Es ist ein Abschied. Eine Etappe, die sich so nicht wiederholen kann, geht zu Ende. Was uns zunächst fremd, war ist uns nun vertraut.
Auf den letzten 100 m übe ich mit Robert noch ein wenig Tschechisch: „Robert, das R muss rollen! Nicht im hinteren, oberen Gaumenbereich knarren. Die Zungenspitze muss kurz unterhalb der unteren Schneidezähne behende flattern.“ Das Sprachgenie an meiner Seite (selbst Englisch klingt aus seinem Mund verry Sächsisch) gibt sich alle Mühe. Ich erkenne eine Verbesserung. Da bewegt sich was. Es gibt Hoffnung.
Heute morgen sind wir früh los. Warum genau, weiß ich auch nicht. Irgendwie waren wir wach. Kurz nach acht sind wir schon auf der Piste. Gegen 13 Uhr erreichen wir nach schier endlosen, immer leicht ansteigenden Kilometern (Mann, das macht mich mürbe.) den 975 m hohen Spitzbergsattel. Es ist einer der höheren Pässe im Böhmerwald. Schon die letzten Kilometer haben wir kaum geredet. Sind gedankenversunken nebeneinander hergetrottet. Auch jetzt hier oben, auf dem höchsten Punkt, verharren wir im stillen Einverständnis. Es ist ein besonderer Moment, oben anzukommen. Irgendetwas scheint überwunden und Neues liegt vor uns. Von nun an geht’s bergab. Jedenfalls vorerst.
Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, worüber wir aber bereits ausgiebig orakelt haben: Wir haben soeben die Europäische Kontinentalwasserscheide überschritten.
Die Úhlava – das kleine, muntere Bächlein, welchem wir die letzten Stunden flussaufwärts folgten – entwässert über Moldau und Elbe in die Nordsee. Der Großen Regen (auf Tschechisch Řezná) entspringt ganz in der Nähe und sein Wasser fließt über die Donau ins Schwarze Meer. Robert lässt sich zurückfallen. Er muss mal in die Büsche. Wohin er nun genau entwässert, Nordsee oder Schwarzes Meer, entzieht sich meiner Kenntnis.
Nun sitzen wir hier in diesem kleinen Schlossrestaurant. Hirschgeweihe und Felle von kleinen Wildschweinen schmücken das Gewölbe. Zwei etwas korpulente, patente und nicht mehr ganz taufrische Schwestern schmeißen den Laden. Die eine spricht ziemlich gut Deutsch mit handfestem bayerischen Akzent. Krass. Rippchen sind aus, Schweinshaxe ist alle, Rehgulasch auch und das Hühnerschnitzel ebenso. Was gibt es eigentlich noch? Die Stimmung ist heiter, wir sind die einzigen Gäste. Robert schiebt die Speisekarte rigoros beiseite und lautstark gestikulierend verkündet er: „Ich möchte 300 g Bratkartoffeln und ein Riesenschnitzel. Ich habe Hunger und möchte satt werden. Was auf der Speisekarte steht, ist mir egal.“ Die Schwestern haben verstanden und sagen dem Koch, der im Gastraum gerade ein Bierchen zischt, kichernd Bescheid. Dieser macht sich mit wild entschlossener Mine auf den Weg in seine Küche. Die Mission ist klar.

22.04.2023
25. Etappe
Von Chudenín nach Zelená Lhota

Kleine Robertsche Abschweifung 5
Schon als jugendliche Sportskanone hatte ich es gehasst, wenn ein Trainer nach dem angekündigten und durchgezogenen Trainingsprogramm noch einen drauf sattelte: „Und nun noch 100 m im Entengang, aber dalli!“ oder so ein Mist.
Alles hatte sich in mir auf diese Trainingseinheit eingestellt, vor allem im Kopf. Hier noch die Klimmzüge, da noch die Liegestütze – und dann bist du fertig, kannst unter die Brause und ab nach Hause. Aber nun kommt noch der beknackte Entengang – das bricht einem dann das Genick. Hätte er das von Anfang an gesagt, wäre das für mich kein Problem gewesen.
Auf selbiges Phänomen stoße ich auf unserer Wanderung: Eine lächerliche 14-km-Tour steht uns bevor, wir bummeln schon beim Aufstehen. Allmählich kommen wir in die Spur, nach guten 3 Stunden werden wir mit Sicherheit am Ziel sein. Glauben wir! Nun kommt es doch ein wenig anders. Der Regen zwingt uns zum Pausieren, ein Weg ist wegen einem bekloppten Fahrradrennen gesperrt, das Navi setzt aus und wir verlaufen uns. Die Stimmung ist am Boden. Wir kommen nach 5 Stunden angeschlagen am Zielort an. Uff, geschafft. Das Navi funktioniert wieder und teilt uns freundlich mit, dass unsere Pension nicht im Dorf, sondern in einer Entfernung von 2,9 km oben auf dem Hügel liegt. Top Aussicht versprochen. Logo. Ich breche innerlich zusammen und krieche auf dem Zahnfleisch den Berg hoch. Alles tut weh, ich komme ausgelaugt oben an. Die Navi-Auswertung besagt:
19 km. Normalerweise kein Problem. Aber wieso bin ich so kaputt?
Nächster Tag. Die billige Pension liegt genau auf unserer Route, ist aber 25 km weg. Anders geht es leider nicht.
25 km? Wir machen uns schon abends vor Angst in die Hose. Ist das für uns überhaupt zu schaffen?
Wir stehen relativ zeitig auf, gegen 8 geht es los. Erste Pause gegen 10 Uhr, da sind schon 9 km geschafft, die Sonne scheint und munter trabt das Duo vorwärts. Ein lustiges Rennsteiglied schmettern wir. Nur gut, dass uns hier im Böhmerwald keiner hört. Nächste Pause nach weiteren 2 Stunden, nun haben wir nur noch 7 km vor uns. Die reißen wir auf einer Backe ab. Fit wie zwei Germina-Turnschuhe erreichen wir nach 25 km locker unsere Unterkunft. Wie kann das sein? Hat jemand eine Erklärung dafür?
Abschweifung Ende
Heute haben wir einen Sonntagsspaziergang gemacht. An einem Sonnabend. Zumindest glaube ich, daß heute Sonnabend ist. Die Tage verschwimmen. Knapp 14 km durch explodierendes Grün. Sonnenbeschienen. Häufig sind wir stehen geblieben. Haben betrachtet, bewundert, bestaunt. Plötzlich sind wir mitten im Böhmerwald angekommen. Seit Tagen zeichnet sich der 120 km lange und 50 km breite Riegel zunächst dunstig und schwach am Horizont ab. „Robert, siehst Du dahinten diesen großen Berg, ganz am Horizont, den mit der Antenne darauf? Ob das wohl der Böhmerwald, ob das wohl Šumava ist?“ Mein etwas schlecht sehender Begleiter kneift die Augen zusammen, dreht den Kopf mal hier-, mal dahin. Sieht nichts. Die Augen werden nicht besser, aber die Berge kommen deutlich näher (was rede ich für einen Unsinn – natürlich kommen die Berge nicht näher, wir nähern uns dem Gebirge), sind nun unübersehbar und majestätisch reiht sich Tausender an Tausender. Der König unter ihnen ist der Große Arber. Er ist 1456 m hoch und die Bayern beanspruchen ihn für sich. Gestern, da bestaunten wir alles noch aus gebührender Entfernung. Heute sind wir mittendrin. Wie schnell das ging.
Ein paar Kilometer wandeln wir auf dem Goldsteig. Heute ein gut ausgeschilderter Fernwanderweg, im Mittelalter eine wichtige Handelsroute von Nürnberg nach Prag. Er brachte Wohlstand und Reichtum und machte sich so seinen Namen.
Bereits gegen 14 Uhr sitzen wir auf einer sonnigen Terrasse mit Blick auf die Berge und einen großen Stausee und trinken Bier. Es herrscht Berghüttenstimmung. Die Wanderer, Biker, Ausflügler im besten Alter, sind aus ihren Löchern gekrochen. Sonnencremeglänzend halten sie ihre dunkel bebrillten Gesichter in die wärmende Frühlingssonne. Vor dem Restaurant stehen einige 10000 Euro in Fahrrädern. Man trägt Funktionskleidung der neuesten Kollektion. Wir sind für heute angekommen.

21.04.2023
24. Etappe
Von Mrákov nach Chudenín

Heute Nacht haben wir in einer umfunktionierten Mühle übernachtet. Das Mühlrad klappert nicht mehr lustig klippklapp, sondern steht dekorativ in der Hälfte geteilt auf dem Rasen herum. Das alte Gemäuer ist nun eine Pension und alles wirkt und ist auch sehr sympathisch. Im urigen Gastraum versammeln sich nach und nach Gäste und Einwohner des Dorfes. Genau halb sieben hocken sie vor dem Fernseher. Es läuft… ? Die Nachrichten? Ein Fußball-Länderspiel? Wetten das? Nein, die Gemeinschaft fiebert mit im Kampf um eine 160 g schwere Hartgummischeibe. Durchmesser exakt 7,62 cm und Höhe exakt 2,54 cm und keinen Millimeter mehr oder weniger. Schwer vermummte Männer kreiseln flink, als tanzten sie einen Wiener Walzer, auf Schlittschuhen durch eine verhältnismässig kleine Arena und schieben den Puck mit einem Schläger vor sich her. Auf bis zu 170 km pro Stunde kann man ihn beschleunigen. Ein Geschoss, würde ich sagen. Das erklärt die Rüstungen der Männer.
In Tschechien ist Eishockey Nationalsportart und populärer als Fußball.
Über 109.000 Spieler, bei einer Gesamtbevölkerung von rund 10,6 Mio. Menschen, üben diese Sportart aus. Auf Grund dessen existiert im Land eine vergleichsweise hohe Eishallendichte und eine sehr gute Nachwuchsarbeit. Daraus wiederum resultieren große Erfolge der tschechischen Nationalmannschaft.
Gestern spielte Tschechien gegen die Slowakei. Interessant aber sicher kein politischer Zündstoff. Den gab es allerdings im Jahre 1969. Wir erinnern uns: 1968 rollten russische Panzer durch Prag und verwandelten den „Prager Frühling“ in einen russischen Winter. Im Jahr 1969 – im Verlauf der Eishockeyweltmeisterschaft in Schweden traf die ČSSR zweimal auf die Mannschaft der UdSSR – und gewann zwei Mal. Die Euphorie im kleinen Land war grenzenlos. Endlich hatte man den Besatzern mal gezeigt, wo der Hammer und sogar die Sichel hängt.
Auch gestern ging es mal wieder gut aus für die Tschechen. Sie gewannen 2:0.
Heute morgen sind wir früh los. 24 km und 560 Höhenmeter liegen vor uns. Das ist bis jetzt unsere größte Herausforderung. Ein bisschen mulmig ist mir. Aber was soll schon passieren. Das Wetter ist gut. Das Thermometer zeigt 10 Grad mehr als gestern. Wir können Pausen machen und uns ausruhen. Wird schon werden.

20.04.2023
23. Etappe
Von Horšovský Týn nach Mrákov

Es kommt noch einen Zacken schärfer und am Ende wird alles gut. Heute morgen, als wir aufwachen, zeigt das Thermometer nur noch drei Grad und es regnet. Was sonst. Die tagelang angekündigte „Kaltluftblase“ hat uns erreicht. Der Unterschied zu gestern? Heute bin ich vorbereitet. Pünktlich um 9 Uhr öffnet die kleine Cukiernia (Konditorei) am beschaulichen Marktplatz von Horšovský Týn ihre Tür und wir schlüpfen hinein. Ein Platz an der Heizung. Einen heißen, süßen Cappuccino, eine Quarktasche mit Heidelbeeren. Ich tanke Energie. Lange Unterhose, dicker Pullover, Mütze, Schal, Handschuhe, ich bin bestens ausgerüstet und mein Rucksack ist quasi leer. Als wir losziehen, baumelt das Navigationsgerät in einem wasserdichten Behälter um meinen Hals, die Route kennen wir auswendig. Nicht andauernd stehenbleiben, Handschuh aus, mit klammen Fingern am nassen Händy rumsuchen. Stramm laufen, davon wird einem warm. Die nächste Möglichkeit der Rast ist in 12 km. Eine größere Menschenansammlung, die Stadt Domažlice. 12000 Menschen wohnen dort. Da kriegen wir sicher eine warme Suppe.
Der Weg vergeht wie im Fluge. Ich friere kein bisschen, der Regen hört schon bald auf. Die Moral ist blendend. Im Vergleich zu gestern stelle ich erneut fest: Wie viel im Kopf stattfindet. Wie entscheidend die Einstellung doch ist.
Auf einer Anhöhe oberhalb Domažlice wird klar, dass wir um ein Thema nicht herumkommen. Wir wissen das seit Tagen, weil wir immer wieder darauf stoßen. Nun aber ist es unumgänglich. Die Hussitenkriege wollen verstanden werden.
Ein Denkmal erinnert hier an die entscheidende Schlacht des fünften Kreuzzuges des Heeres des römisch-deutschen Königs Sigismund (zugleich König von Ungarn und Böhmen) und seinen katholischen Verbündeten gegen die Anhänger des als Ketzer hingerichteten Prager Theologen Jan Hus.
Wir kramen in unseren Köpfen: der 1. Prager Fenstersturz 1419. Der Theologe, Prediger, Reformator Jan Hus, der 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, weil er seine Thesen nicht widerrufen wollte. In Tschechien ist er ein Nationalheld. Und schon ist Schluss. Etwas dünn. Damit müssen wir uns beschäftigen, wir sind ja schließlich noch ein paar Tage hier. Und unbedingt auch noch mit den ebenbürtigen Nationalhelden: Spejbl und Hurvínek, der kleine Maulwurf… und Karel Gott.
Im langen Endteil auf Domažlice: „Robert, wenn wir da sind, da gehen wir in ein restaurace (Restaurant) und bestellen uns eine gulášová polévka (Gulaschsuppe) und einen černý čaj s citronem (schwarzen Tee mit Zitrone). Danach gehen wir in einen Laden und kaufen potraviny (Lebensmittel), pivo (Bier) und červené víno (Rotwein).“ Beifallsheischend schiele ich auf meinen Begleiter und fühle mich sehr tschechisch.

19.04.2023
22. Etappe
Von Mezholezy nach Horšovský Týn

Heute bin ich mürbe geworden. Müde der Kälte und des Regens. Dabei fing alles so wunderbar an. Als wir heute morgen aufwachten in unserem kleinen Häuschen, war dies ordentlich ausgekühlt. Denkbar schlecht, eigentlich gar nicht isoliert, würde ich sagen. Es wäre übertrieben, an dieser Stelle die Eisblumen am Fenster zu beschreiben… es gab keine, aber es war ordentlich frisch.
Ich lag in meinem Bett, zugedeckt bis an die Nase, den dicken Pullover hatte ich schon vorsichtshalber gestern Abend angezogen und konnte mich nicht überwinden, auch nur den großen Zeh aus dem Bett zu strecken. Da sprach eine wohlbekannte, liebe Stimme neben mir den entscheidenden Satz: „Huhni, soll ich uns eine kleine Husche machen?“ Und 20 Minuten später loderte das Feuer im Öfchen wieder und verbreitete seine unvergleichlich gemütliche Wärme. Eingemummelt in meine Decke sitze ich auf meinem Stammplatz auf dem Sofa und schlürfe einen Kaffee. Das Thermometer zeigt 5 Grad und es regnet. Wir gehen unsere heutige Route durch und betrachten das Wetter. Nur 15 km heute, kaum nennenswerte Steigungen und ab Mittag Sonne satt. Ich bin optimistisch. Wir lassen das Feuer runterbrennen, packen unsere Sachen, machen Klarschiff im Haus und los geht es. Pullover und lange Unterhose sind im Rucksack. Die Sonne soll scheinen. Schon nach wenigen Kilometern sinkt die Moral auf unter Null. Wir stapfen durch die Siebenberge. Durch wunderschöne bemooste Nadelwälder. Überall liegen riesige Granitblöcke umher. Einzeln oder in interessanten Formationen aufgetürmt. Man könnte darauf herumklettern oder Verstecken spielen oder was auch immer… es regnet eisigen Regen, es pfeift der Wind, es ist grau, es ist dunkel wie in der Dämmerung... und das schon mit wenigen Unterbrechungen seit Tagen. Die Zermürbung findet im Kopf statt. Es war Sonne angesagt und nun bestehe ich innerlich verzweifelt darauf.
Ich muss an das „Jahr ohne Sommer“ denken. Davon habe ich das erste Mal vorgestern in Stříbro gehört. Wir haben uns, wie gewöhnlich, mit der Geschichte der Stadt beschäftigt, in der wir Quartier gefunden haben. Stříbro heißt Silber und der Name beruht auf den Abbau dieses Edelmetalls in der Gegend. Die Geschichten der Städte gleichen sich. Es kam die Pest, es kam die Cholera, es kam der 30jährige Krieg, später Napoleon. Mindestens einmal brannte die ganze Stadt ab. Und es gab Hungersnöte. Das Jahr 1816, als das Elendsjahr „Achtzehnhundertunderfroren“ berüchtigt, hatte eine solche Hungersnot zur Folge. Es ging als das „Jahr ohne Sommer“ in die Geschichte ein. Schuld daran war wahrscheinlich der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora. Er hatte Staub, Asche und Schwefelverbindungen in die Atmosphäre geschleudert und so einen vulkanischen Winter ausgelöst. Die Folge war ein ungewöhnlich kalter Wetterverlauf in Europa mit Ernteausfällen, schweren Unwettern und Überschwemmungen, Missernten und Schneefall in höheren Lagen das gesamte Jahr hindurch. Naja und dann kam das hausgemachte Elend obendrauf, die Teuerungen. Mit dem Hunger kamen Typhus und Pest.
Kontinentaleuropa war nach einem Vierteljahrhundert der Kriege angeschlagen, hinzu kam das Chaos, das Migration und die Demobilisierung mehrerer Millionen Männer nach Ende der napoleonischen Kriege auslösten.
Ein paar interessante Spätfolgen hatte diese Katastrophe. Noch Jahrzehnte später bedingte der Vulkanausbruch eine merkliche Veränderung des Tageslichts. Besonders ausgeprägt war dies abends und morgens, wenn die Sonnenstrahlen auf ihrem dann längeren Weg durch die Atmosphäre auf eine Vielzahl von Aerosolpartikeln stießen. Die biedermeierlichen Sonnenuntergänge in der Malerei waren von nie dagewesener Pracht – in allen Schattierungen von Rot, Orange und Violett, gelegentlich auch in Blau- und Grüntönen.
Davon hatte ich bisher nichts gehört. Dazu musste ich erst in dieses kleine Bergstädtchen kommen.
Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen. Es wird heller. Irgendwo ganz hinten habe ich einen kleinen Fetzen blauen Himmels entdeckt. Los Sonne, zeig Dich endlich! Aus dem Wald, durch welchen wir laufen, wird fast unmerklich ein Park. Wir sind im Landschaftspark von Schloss Horšovský Týn angekommen, unserem heutigen Ziel. Ein opulentes Schloss mit Kleinstädtchen drumherum.
Täglich erleben wir neue Überraschungen in unseren Herbergen. Heute übernachten wir in einem Schlosszimmer. Mit Grammophon und freistehender Badewanne im Schlafzimmer. Gleich noch gehe ich in die Drogerie und kaufe mir ein Fichtennadelschaumbad und nehme ein Bad. Und wenn ich fertig bin, dann kann Robert noch in das Wasser. Da lassen wir noch ein bisschen Heißes dazu. Die altbekannte Reihenfolge. Und ganz zum Schluss waschen wir noch unsere muffigen Socken und Unterhosen darin.

18.04.
21. Etappe
Von Stříbro
nach Mezholezy

Kleine Robertsche Abschweifung 4
Wir schlurfen die Landstraße entlang und Martina macht mich auf dunkle Gebilde aufmerksam, die im 300-m-Abstand auf den Feldern herumlungern. „Sieht aus wie Bunker“, meint sie etwas naseweis. „Bunker in dieser Gegend“, doziere ich (absoluter Militärexperte), „die können hier nicht sein. Hier gab es nie Kämpfe. Das sind wahrscheinlich Wassertanks – oder so.“ Martina (absolute Null was Militärisches anbelangt) weist auf Schießscharten hin. Ich werde nachdenklich. Ein paar hundert Meter weiter erscheint ein weiterer Bunker, diesmal unverkennbar. Ein Sperrschild verbietet das Näherkommen, aber es gibt eine www-Adresse. Am Abend gehen wir der Sache nach.
Es stellt sich heraus, dass mit der Machtergreifung der Nazis die junge tschechische Republik die Kriegsgefahr erkannt und Maßnahmen zur Verteidigung ergriffen hatte. Von 1936 bis 1938 baute sie mehrere Sperrriegel entlang der deutsch-österreichischen Grenze. Bunkeranlagen, ähnlich der Maginot-Linie in Frankreich sollten einen Einmarsch der Nazitruppen verhindern und eine Abwehr ermöglichen. Die Tschechen hatten eine respektable Armee und waren wild entschlossen, ihr kleines Land zu verteidigen. Mit diesen von mir als Wassertanks eingestuften Verteidigungsanlagen hätte es gelingen können.
Das Münchener Abkommen brach den Tschechen das Genick. England, Frankreich und Italien kasperten mit Hitler einen Deal aus (ohne Beteiligung der Tschechen), bei dem die tschechischen Sudetengebiete an Großdeutschland fielen. Leider lagen die wichtigsten Verteidigungsanlagen genau in dieser Region. Die Wehrmacht besetzte das Gebiet und wenige Tage später marschierte sie völkerrechtswidrig bis nach Prag durch. Die gesamte tschechische Armee wurde Beute der Deutschen. Skoda-Panzer schossen wenig später in Polen, tschechische Bomber bombten bis kurz vor Paris. „Was machen wir nun mit den vielen Bunkern“, fragt Martina, die angehende Militärexpertin. „Die Schießscharten zukleistern“, sage ich „und Wasserspeicher draus machen. Was denn sonst.“
Abschweifung Ende
„Mann, ist das gemütlich. Robert, findest Du es auch so gemütlich wie ich? Ist es nicht schön hier? Ist es nicht einmalig und wunderbar?“
Wohlig wie eine Katze lümmele ich auf einem kleinen Sofa und schwärme vor mich hin. Im Kamin flackert ein Feuer. Der kleine Raum hat geweißte Wände, einen gewienerten Holzfußboden. Eine kleine Stiege führt nach oben. Rotweißkarierte Vorhänge schmücken die Fenster, der Blick geht ins Grüne. Unser Quartier ist ein kleines Häuschen im Wald. Klein, mit einem spitzen Giebel. Ein See vor der Haustür. Das Essen haben wir die letzten 15 km mitgeschleppt. Hier kann man nichts einkaufen.
Wir sind in den Siebenbergen (Sedmihoří) angekommen.
Sedmihoří ist ein kleines Gebirge, abgeschieden und touristisch kaum erschlossen. Das überwiegend bewaldete Gebiet, insgesamt umfasst es gerade 36 Quadratkilometer, wird von einer Senke gebildet, die im Süden, Westen und Norden von einer Krone aus elf Gipfeln umgeben ist, alle so zwischen 550 und 600 m hoch. Zum Vergleich: Schwerin beansprucht eine Fläche von 130 Quadratkilometern. Die Bergkette ist vulkanischen Ursprungs. Es gibt zwei Theorien über ihren Ursprung. Die erste besagt, dass dies mehrere separate Überreste von Vulkanen sind. Die zweite Theorie besagt, dass die Bergkette der Überrest eines massiven Supervulkans ist. „Supervulkan“ - das klingt spannend.
Ja und hier sind wir heute nach sieben Wanderstunden gelandet. 420 spannende Minuten auf tiptop ausgeschilderten Wanderwegen. Abwechslungsreich, interessant, zum Staunen schön. Genau wie alle Tage vorher. Vor der Wende, da sind sie alle an den Balaton gerammelt und nach Bulgarien. Auf den knapp 3000 m hohen Musala im Rilagebirge sind die Ossis hochgelatscht und am Schwarzen Meer haben sich alle wiedergetroffen. Ich kenne keinen, der schon mal in den Siebenbergen war oder eine Tschechoslowakeiquerung vorweisen kann. Dabei war die ČSSR unser nächster Nachbar. Aber so richtig gefetzt hat das dann irgendwie doch nicht.
Hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen… Genau so fühle ich mich gerade. Wie im Märchen. „Robert los, wir machen uns noch einen Grog.“

17.04.2023
20. Etappe
Von Konstantinovy Lázně nach Stříbro

Heute morgen sind wir in Konstantinopel aufgewacht. Und das ging so…
Schon von Anbeginn unserer Reise spielen wir, während uninteressanterer Passagen unserer Wanderungen, das Spiel „Ich packe meinen Koffer“ und zwar mit den Orten, an denen wir Quartier gefunden haben. Ich sage „Schwerin“, Robert sagt „Ludwigslust“, ich sage „Seehausen“ und so weiter. Seit dem wir in Tschechien unterwegs sind, gerät Robert ins Straucheln. Die Namen der Orte, in denen wir logierten, wollen nicht in seine Rübe. Die ganzen Zischlaute und unaussprechlichen Ansammlungen von Konsonanten tanzen in seinem Kopf einen Reigen. Manchmal mache ich einen Test und frage „Robert, wo gehen wir gerade hin?“ - die Antwort bleibt aus.
Als ich heute morgen fragte: „Robert, in welcher Stadt sind wir gerade aufgewacht?“ kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Konstantinopel, wo sonst“, und er lacht mir voll stolz ins Gesicht.
Konstantinovy Lázně – Konstantinsbad. Darüber lässt sich soviel nicht erzählen. Der hübsche 920-Seelen-Ort befindet sich etwa 40 km nordwestlich von Pilsen in einer sehr waldreichen Gegend. Der Status als Kurort beruht auf schwefelhaltigen Stinkerquellen. Da komme ich ins Kichern. „Stinkerquellen“. Es gibt ein Dum Kultury und ein jährlich stattfindendes Folkfestival. Ansonsten hauptsächlich ältere Menschen mit Gehhilfen.
Wir ziehen weiter. Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Die Touren und Übernachtungen planen wir zwei Tage im Voraus und zwar gemeinsam. Der Navigator in der Reisegruppe Weidner/Loest bin ich.
Kleine Robertsche Abschweifung 3
Navigation? Erstmalig gab es in unserer heutigen Pension eine Waage. Ich navigiere mich auf dieses Ding und stelle fest: 80 kg Lebendgewicht. Nichts anderes als am Reisebeginn, was habe ich denn erwartet? Wir verlassen das Hotel, Martinas Händy, also unser Navi, baumelt um ihren Hals und kräht: „Abbiegen auf Novalukskaja Dingselbumselulica. Folgen Sie 300 Meter.“ Wir gehorchen und Martina übernimmt das Weitere. Die Strecke von knapp 20 km ist programmiert und wenn nichts Übles passiert, werden wir nach ca. 5 Stunden ankommen. Logisch, wäre doch gelacht! Es geht steil hoch in den Wald und wir kommen an eine Wegkreuzung. Was sage ich, mindestens sechs Wege treffen sich hier, um sich gegenseitig zu verwirren. Wir stehen da und Martina befragt das Händy. Was sie da eigentlich treibt, ahne ich nur. Irgendein Pfeil zeigt wahrscheinlich in die vermeintlich richtige Richtung. Martina prüft und macht. Ich hingegen stehe im „Langen Hänger“ im Wege herum. „Langer Hänger“ heißt: Die Schultern nach vorn gebeugt, fröstelnd die Hände in den Taschen, ein starrer, stumpfer Gesichtsausdruck ins Leere, zur Hilflosigkeit und zum Warten verdonnert.
Endlich hat Martina den Weg gefunden. Hier geht’s lang! - 80 kg setzen sich mühsam in Bewegung. - „Vielleicht“, kommt die ernüchternde Ergänzung. 80 kg müssen gestoppt werden und verfallen wieder in den Langen Hänger. Martina sucht weiter. „Also doch hier entlang, wie ich schon dachte.“ - 80 kg beschleunigen wieder auf Schritttempo. „Glaub ich jedenfalls“, kommt die nächste Einschränkung. - 80 kg werden abgebremst und zum Stillstand gebracht. Und wieder ab in den Langen Hänger.
Nachfragen über die Geschehnisse sind sinnlos und kontraproduktiv. Schlichte Fragen wie: „Was zeigt es denn an? Sind wir noch auf der vorprogrammierten Route?“ Oder: „Wo klemmt´s denn?“, werden im schlimmsten Fall gekontert mit: „Willst Du die Navigation übernehmen? Mach doch selber!“
Davon bin ich natürlich weit entfernt. Meine Beiträge zur Navi beschränken sich auf gelegentliche Hinweise auf die Himmelsrichtung, Wenn mir mal die Sonne in den Nacken scheint, sage ich: Huhni, wir gehen nach Norden, das ist die falsche Richtung. Ob das wohl seine Richtigkeit hat?
Nach der geplanten und programmierten Zeit von 5 Stunden erreichen wir punktgenau unser Ziel.
Abschweifung Ende

16.04.2023
19. Etappe
Von Nečtiny nach Konstantinovy Lázně

„Wünschen gut geruht zu haben Euer Gnaden!“
„Wie geht es Ihnen heute morgen, hochwohlgeborene gnädige Frau?“
„Pflegten sie gut zu träumen, Durchlaucht?“
Wir haben wunderbar geschlafen, fühlen uns pudelwohl in unserem Schloss und so albern wir noch eine Weile im Bett herum.
Der Abschied fällt uns heute etwas schwerer. Eine ähnliche Immobilie wie diese wäre in Deutschland eine Luxusherberge. Mit einem Rondell vor dem Eingangsportal. Der weiße Kies knirscht, wenn die Luxuslimousinen vorfahren, Türen werden aufgehalten. In den Hotelfluren wandeln die Superreichen in weißen Bademänteln, sie kommen gerade aus dem Wellnessbereich.
Hier bröckelt die einst protzige Fassade. Der Bitumen vor dem Eingang ist rissig und buckelig. Die Wurzeln der alten Bäume im Hof tun ihr Werk. Die Räume sind einfach und geschmackvoll eingerichtet, mit liebevoll selbst gestalteten Objekten dekoriert. In den hohen Fluren lärmen Kinder. Ein Tischkicker steht herum. Junge Betreuer mit Gitarre auf der Schulter schleppen die Rucksäcke der Kinder von A nach B. Ein kleiner Rollstuhl steht in der Ecke.
So finden wir es gut. So ist es richtig. Hier ist Leben. Hier dürfen normale Menschen anwesend sein und Freude am alten Gemäuer haben, es beleben.
Wie fast immer brechen wir gegen halb zehn auf und es scheint die Sonne. UND ES SCHEINT DIE SONNE! Unfassbar. Wie verändert die Welt ist. Seit Tagen laufen wir durch feuchte, kalte, nebelige Landschaft. Das war nicht ohne Reiz, aber nun kehrt Energie zurück. Irgendetwas entspannt sich in mir.
Unser Weg führt, wie alle Tage vorher, abwechslungsreich durch hügelige Landschaft. Wälder, Wiesen, Dörfer wechseln sich ab. Ich hätte nie gedacht, wie schön es hier ist. Die kleinen Dörfer, manchmal sind es nur eine Handvoll Häuser, sind gut in Schuss. Den Leuten scheint es gut zu gehen. Im Gegensatz zu den deutschen Gegenstücken liegt die Priorität hier eher auf dem etwas verwilderten, urigen Bauerngarten, als auf dem antiseptisch reinen, von jedem Unkraut befreiten Vorgarten. Wir sehen keinen einzigen Rasenmäher-Roboter. Und es gibt Kinder. In jedem Dorf, und sei es noch so winzig, gibt es einen zentral gelegenen kleinen Spielplatz. Mit Schaukel, mit Rutsche und einem frisch gestrichenen Klettergerüst. Hier hängt nicht eine verwitterte Holzschaukel an einem verrosteten Gestell, welche monoton im Wind vor sich hin quitscht und traurig von alten Zeiten singt. Hier scheint gespielt und getobt zu werden. Das ist gut.
Wir machen eine Pause und entledigen uns unserer Jacken. Mann, ist das warm. Gestern träumten wir noch von einem kleinen tschechischen Gasthof, in dem man sich aufwärmen könnte. Eine Suppe, ein steifer Grog, um die klammen Finger zu wärmen. Heute wünschen wir uns einen schattigen Biergarten. Dort könnten wir ein kühles Bierchen zischen oder eine Fassbrause, um uns zu erfrischen. April, April genau so muss es sein.
In Konstantinovy Lázně angekommen geht der Wunsch in Erfüllung. Auf der Straße stehen vor einer kleinen Gaststätte ein paar Tische und Stühle in der Sonne. Es wird gerade ein Tisch frei. Wir bestellen uns jeder ein großes Bier. Was denn auch anderes, Pilsen ist nur einen Steinwurf entfernt. Und hier treffen wir ihn endlich. Den Prototyp des tschechischen Oberkellners. Groß und schlank ist er, fast ein bisschen hager. Er trägt ein weißes Hemd, eine rote Weste, eine dunkle Hose. Die besten Jahre hat er hinter sich, die Schläfen leicht angegraut, der Teint etwas fahl. Das Alter? Undefinierbar. Irgendetwas zwischen 35 und 55. Er läuft zügig, aber nicht hastig, den Oberkörper immer leicht nach vorne gebeugt. Er sagt andauernd „bitte schejn und danke schejn“ und hat ein schwejksches Grinsen im Gesicht. Ein Hauch von Melancholie umweht ihn wie ein zartes Parfum. Er schmeißt den Laden mit Bravour. Er bedient nicht nur den Freisitz und die Tische im Gastraum, er zapft auch noch das Bier und entkorkt gekonnt die Weinflaschen. Für jeden hat er ein freundliches Wort. Ein absoluter Profi. Was für ein Unterschied zum Gasthaus in Thum, wo Abiturienten und Trockenbauerinnen als Aushilfskellner (siehe 07.04.) Chaos verursachten.
Hier gehen wir heute Abend essen. Es ist schließlich Sonntag.

15.04. 2023
18. Etappe
Von Žlutice nach Nečtiny

Es regnet und regnet und regnet. Heute Nacht bin ich ein paarmal aufgewacht. Habe aus dem Fenster geschaut. Direkt vor unserem Fenster hängt eine alte Laterne und wirft gelbliches Licht auf das Kopfsteinpflaster. Darunter hat sich eine große Pfütze gebildet. Im Kegel des trüben Lichtes sehe ich den peitschenden Regen und die Blasen, welche die Tropfen auf dem Wasserspiegel hinterlassen. Trostlosigkeit in einem gottverlassenen tschechischen Bergdorf. Schnell wieder unter die warme Bettdecke.
Der Tag beginnt mit einem Pfefferminztee, der üblichen Zusammenkramserei und wir gehen die Route noch einmal durch. Es regnet immer noch.
Gegen halb zehn verlassen wir das Haus. Es geht ziemlich bald wunderbar bergauf. Wir werden munter, uns wird es warm und der Regen lässt nach.
Wir sind etwa anderthalb Stunden unterwegs, machen gerade Frühstückspause, da klingelt das Telefon. Unser Fliegerfreund Bernd Bombis ist dran. Vor unserer Abreise habe ich mich mit ihm verabredet. Er hatte einen Wunsch, dem ich ihn gerne erfülle. Jeden Abend schicke ich ihm einen Abendgruß in Form der Koordinaten unseres aktuellen Quartiers. Das mache ich gerne, vergesse es nie und nun fragt er mich, wo wir denn gerade wären… er wäre dann in 20 Minuten da. Uns fällt die Kinnlade runter. Nach einigem Hin und Her gabelt er uns am Wegesrand auf. Beweisfotos sind angefügt.
Eine halbe Stunde sitzen wir in seinem verqualmten Auto und reden. Die Heizung bullert volles Rohr und das ist auch bitter nötig. Es ist lausig kalt draußen.
Heute morgen halb sechs ist er in Schwerin aufgestanden, hat sich noch einen Kaffee geholt und ab in den Süden. Es ist schön, dass wir uns sehen. Es fühlt sich vertraut an und ein bisschen unwirklich. So schnell wie er kam, verschwindet er wieder. Wir winken lange.
An dieser Stelle sei deutlich anzumerken, dass wir seinem Angebot, mit dem Auto mitzufahren, widerstanden. Es wären 8 Minuten mit dem Auto bis zu unserem heutigen Ziel. Zu Fuß sind es noch 3 Stunden.
Heute Nacht reden wir uns mit „Sie“ an. Ich bin Frau Hochwohlgeboren und Robert möchte mit „Euer Gnaden“ angeredet werden. Wir übernachten in einem Schlosshotel. Das Schloss im neobarocken Stil liegt oberhalb des Ortes Nečtiny in den nordwestlichen Ausläufern des Rakonitzer Hügellandes. Es ist ein ziemlich ausladendes aber auch recht abgehalftertes, etwas heruntergekommenes Anwesen. Der Lack ist ab, es hat seine beste Zeit hinter sich. Aber gerade das wirkt sehr charmant. Geht es uns nicht auch so, lieber Robert?

14.04.2023
17. Etappe
Von Stružná nach Žlutice

Ostrov/Schlackenwerth, Nová Víska/Neudörfel, Stružná/Gieshübel, Bochov/Buchau, Žlutice/Luditz. All die tschechischen Dörfer, welche wir durchwandern, trugen einst deutsche Namen und diese sind bis heute bekannt. Seit Tagen durchstreifen wir eine Gegend, in der bis 1945 zu 99% deutsch gesprochen wurde. Wir denken viel darüber nach, lesen, sprechen darüber, versuchen zu verstehen. Es gab eine Zeit in der k.und k. Monarchie, zu der auch Böhmen gehörte, da spielte die Abstammung eine untergeordnete Rolle. In diesem Gemischtwarenladen der Nationalitäten und Religionen lebten Österreicher, Ungarn, Tschechen, Slowaken, Juden, Italiener, Ruthenen, Jugoslawen und und und weitestgehend friedlich miteinander. Mehrsprachigkeit war die Normalität. Die Speisekarten in den Restaurants waren in bis zu vier Sprachen verfasst. Eine frühe Form der heutigen EU? Infolge des 1. Weltkriegs zerfiel die Donaumonarchie und die Tschechoslowakei wurde gegründet. Auch diese zunächst ein Vielvölkerstaat.
Wann es genau begann, vermag ich nicht zu sagen, ich bin kein Historiker, aber irgendwann brach die Krankheit mal wieder aus. Das üble Leiden des Nationalismus griff, einer Seuche gleich, um sich.
Mit dem Erstarken der deutsch-nationalen Kräfte und der Machtübernahme der NSDAP in Deutschland witterten die Nationalisten in den Sudetengebieten Morgenluft und agierten aktiv gegen die tschechische Republik. Letztendlich forderten sie die Eingliederung ins Deutsche Reich. Nach dem Münchner Abkommen von 1938 besetzten die deutschen Truppen „legal“ die Sudeten. Wenig später überrannten sie auch die tschechischen Gebiete, einschließlich Prag. Die Regierung flüchtete ins Exil nach London.
Das kurzfristige Ziel der nationalsozialistischen Besatzungspolitik lag in der Ausbeutung der tschechischen wirtschaftlichen Ressourcen für den Krieg. Langfristig beabsichtigten sie eine „Germanisierung“ des Raumes in Verbindung mit der Vernichtung des tschechischen Volkes als ethnischer Einheit.
Was haben sie für ein Leid über die Menschen gebracht. Massaker, Massenhinrichtungen, Massenvertreibungen. Konzentrationslager wurden errichtet.
Nach Kriegsende kommt die Regierung unter dem damaligen Präsidenten Edvard Beneš aus dem Exil zurück. Im Gepäck die Beneš-Dekrete. Einige von ihnen beschäftigen sich mit der Umsiedlung der sudetendeutschen Bevölkerung aus Tschechien. Zu groß ist die moralische Schuld, welche sie auf sich geladen haben, zu groß die Kriegsverbrechen der Deutschen gegen die tschechische Bevölkerung.
Im Dorf meiner Großeltern in Thüringen stand unten am Bach ein kleines Haus. Eher ein Häuschen. Hier lebten zwei alte, sehr freundliche Menschen. Wir Kinder mochten sie. Sie wirkten friedlich und genügsam. Sie sprachen deutsch mit einem sehr merkwürdigen Akzent. Sie waren Vertriebene aus dem Sudetenland.
Es sollte ein humane, geordnete Angelegenheit werden, diese Umsiedlung. Wir haben heute in Bochov eine Tafel mit einem Transportplan gesehen. Zweimal im Monat kam ein Zug und brachte die Menschen nach Bayern, Hessen oder Sachsen. 30 kg Gepäck und 70 Reichsmark waren jedem zugestanden. Leider blieb es nicht dabei. Schon kurz vor dem eigentlichen Kriegsende kam es zu wilden Vertreibungen. Zu groß ist der Hass, zu groß die Wut auf die Besatzer. Zu groß die Demütigung. Ventilartig entlädt sich dieser Gefühlsstau. Es kommt zu brutalen Exzessen und mörderischen Vergehen gegen die deutsche Bevölkerung. Hastig werden sie auf Todesmärsche geschickt und zu Zwangsarbeit verpflichtet. Das bisher tadellose Volk der Tschechen lädt Schuld auf sich. Tat es in den Augen der Weltöffentlichkeit Ihren Peinigern gleich, mit grausamen und unzivilen Methoden.
Es ist eine Verkürzung der Geschichte, aber ich weiß nicht, ob es mir hilft, noch mehr Hintergründe zu kennen, noch mehr Zahlen, noch mehr Namen. Seit Tagen drehen sich meine Gedanken darum. Es ist die traurige Geschichte, wie aus Opfern Täter werden und dann wieder Opfer. Wo ist der Ausweg aus dieser Spirale? Wann wird man je versteh`n?
Unsere heutige Etappe hat große Freude gemacht. Unvorstellbar bei 5 Grad und Nieselregen? Wir folgen den ganzen Tag einem tschechischen Fernwanderweg. Die rot-weißen Markierungen wirken so frisch und fast noch feucht, als ob gestern ein Wanderwegmarkierer mit Farbtöpfchen vor uns hergelaufen wäre. Der Weg ist ganz liebevoll ausgesucht. Führt über kleine Sträßchen, Waldwege und schmale Pfade, durch feuchte dampfende Täler, entlang langgestreckter Höhenzüge mit schönen Ausblicken und quert verschlafene Dörfer. Es ist schön, draußen zu sein. Es ist schön, jeden Morgen die wenigen Sachen in den Rucksack zu packen und ins Ungewisse aufzubrechen. Es ist schön, jeden Tag neu wieder anzukommen, ganz hungrig und rotbäckig, und aus dem einfachsten Essen wird ein köstliches Mahl. Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.

13.04.2023
16. Etappe
Von Karlovy Vary nach Stružná

Heute morgen haben wir es zum ersten Mal getan. Gesündigt haben wir. Ihr Name ist „Diana“. Ihre Maße: 10 m lang, 2 m breit und sie wiegt üppige 3 Tonnen. Diana heißt die kleine Standseilbahn, welche seit über 100 Jahren Kurgäste aus dem Tal der Tepla zum Aussichtsturm auf dem Karlsbader Hausberg bringt. Sie überwindet dabei in ca. 7 Minuten 200 Höhenmeter. Das Gefälle beträgt 45 Grad. Es gibt eine Zwischenstation. Diana ist ein öffentliches Verkehrsmittel und die wollten wir nur im äußersten Notfall benutzen.
Wir sind mit dem Bähnchen nach oben gezuckelt, danach 200 Meter wieder abgestiegen und dann den nächsten Hügel wieder hinauf. Um mit dem Vehikel zu fahren, haben wir unsere Tagesetappe um etliche Kilometer verlängert. Robert hat darauf bestanden – eine echte Flause würde ich sagen. Aber schön war's.
Unser Weg führt uns durch das Karlsbader Gebirge. Auf Tschechisch klingt das auch gut, finde ich: Karlovarská vrchovina. Der höchste Gipfel dieser kleinen Formation ist immerhin 982 m. Aber so hoch kommen wir nicht. Zunächst lustwandeln wir noch im Einzugsbereich der Karlsbader Kurgäste. Doch bald werden Aussichtspunkte mit Bank, schattige Pavillions, Gedenksteine und künstliche Grotten weniger. Wir laufen durch dunkle Wälder, entlang grüner Wiesen, immer mal wieder überqueren wir ein Bächlein. Die Landschaft ist sanft hügelig, die Pfade geschwungen. Nichts Schroffes gibt es hier, nichts, was das Auge stört. Die Wanderwege sind klar und deutlich ausgeschildert. Für wen wohl? Wir treffen außer ein paar Waldarbeitern niemanden. Die kleinen Dörfer, welche auf unserem Weg liegen, machen einen beschaulichen, friedlichen Eindruck, wäre da nicht die andauernde Kläfferei. Der tschechische Hofhund bei seiner Arbeit.
Kleine Robertsche Abschweifung 2
Warum geht Martina im Zickzack die Dorfstraße entlang, obwohl sie nichts getrunken hat?
Ursache dafür sind die böhmischen Hofhunde, die kläffend, schnaufend und bellend, wie bekloppt hinter den Zäunen entlang keuchen. Sobald so ein Kläffer auftaucht,
wechselt Martina geschwind die Straßenseite. Gegenüber angelangt, kommt das nächste Untier. Also wieder rüber. Die Geschwindigkeit des Wechsels hängt mit der Größe des Vierbeiners, der Lautstärke
und der Höhe des Zaunes zusammen. Also großer Hund, geringe Zaunhöhe und barbarisches Geheul beschleunigen das Tempo des Seitenwechsels enorm. Die Gefahr, bei diesem Zickzacklauf vom Bus
überfahren zu werden, ist natürlich viel größer, als vom Dorfschnuffi in den Po gebissen zu werden. Trotzdem bestärke ich Martina in der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit ihres Tuns. Dies wiederum
stärkt ihr Selbstbewusstsein, welches sie im Umgang mit ihren Fliegerkollegen bitter nötig hat. Abschweifung Ende
Für ein Picknick ist es heute zu kühl und zu windig. Wir setzten uns kurz in die Bushaltestelle von Pila und essen geschwind einen Happs. Ein Bus kommt nicht. Als wir nach 18 km und 6 kurzweiligen Wanderstunden an unserem Etappenziel ankommen, sind wir gerade mal 10 km Luftlinie vom Startpunkt entfernt. Wir sind einen Riesenbogen gelaufen. Heute haben wir nicht den kürzesten, sondern den schönsten Weg gewählt und es hat sich gelohnt. Unser Quartier für heute Nacht fällt unter die Kategorie: unglaublich. Ich kann das nicht beschreiben, ich muss das fotografieren. Den Schlafsaal für 10 Personen teilen wir mit Niemandem. Jetzt aber Schluss. Gleich ist Vorstandssitzung. Ich freue mich darauf, die Kollegen wiederzusehen.
12.04.2023
Kleine Robertsche Abschweifung 1
Karlsbad (KB) ist mit seinen Gebäuden aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg einfach prächtig. Vor mehr als 35 Jahren war KB ähnlich verwampert wie der übrige Ostblock. Doch vielen der zahlreichen Besucher war das egal, sie kamen nicht als Touristen, sondern wollten sich dort mit ihren Freunden, Liebsten und Verwandten aus dem jeweils anderen Teil Deutschlands treffen.
In den achtziger Jahren begann die große Ausreisewelle aus der DDR. Tausende Bürger erhielten ihre längst beantragten Ausreisedokumente und mussten zügig das kleine Land verlassen. Abschied von den eng verbundenen Menschen musste genommen werden, wann wird man sich wiedersehen? Einmal in den Westen ausgereist, gab es in der Regel kein Zurückkommen. Und die DDR hatte den Anspruch, ewig zu bestehen. Vielleicht nicht gerade 1000 Jahre, das hatten wir ja schon. Aber an eine Maueröffnung war nicht zu denken und niemand glaubte, dass die schon nach wenigen Jahren erfolgen würde. Und so kam natürlich die Frage auf, wo man seine Liebsten treffen könnte. Und da bot sich KB an. Von der DDR aus visafrei mit eigenem Kfz oder dem Zug namens „Karlex“ gut zu erreichen, vom Westen aus ebenso. Und so verabredeten sich nun die aktuellen und ehemaligen Ostgermanen in KB, mieteten überteuerte Quartiere und ließen es sich gut gehen. Die neuen „Bundies“ brachten Schallplatten und reale Information aus dem Westen mit. Die teilweise ausreisewilligen Ossis wollten wissen: Wo kann man im Westen arbeiten, wo studieren, was sollen wir als Wertanlage mitbringen? Der Neuwessie gab kluge Antwort: Arbeiten brauchst du erst mal nicht, es gibt Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. Krankenkasse sowieso. Briefmarken und Gold und Meisner Porzellan aus DDR-Produktion verscherbelt lieber zu Hause, aber alte Spieluhren, Käthe-Kruse-Puppen und nostalgische Fotoapparate gehen in Köln gerade gut. - Sollen wir den Trabbi mit in den Westen bringen? - Bist Du irre!!?
Was keiner richtig ahnte: KB war ein Tummelplatz für die Stasi in übler Symbiose mit dem Geheimdienst der Knödelkommunisten. Alles wurde notiert, Kennzeichen aus Ost und West, Meldezettel der Privatquartiere, am Bahnhof wurden Begrüßungs- und Abschiedszeremonien mit Teleobjektiven fotografiert und ausgewertet. So mancher Ausgereiste oder in der DDR-Gebliebene konnte diese Dokumente in seiner Stasi-Akte nachlesen. Für manche eine schöne Erinnerung, für manche ein böses Erwachen aufgrund der Berichte ihrer vermeintlichen Freunde.
Woher ich das weiß? Vieles davon selbst erlebt und einiges nachgelesen. Abschweifung Ende

11.04.2023
15. Etappe
Von Ostrov nach Karlovy Vary

Es ist grau, es regnet, es ist windig und kalt. Wir haben heute den kürzesten Weg nach Karlsbad gewählt. Gegen 10 betreten wir einen Lehrpfad der menschlichen Mobilität. Zunächst geht es parallel zur tosenden Autobahn über eine feuchte Wiese. Immerhin hat uns unsere Wanderapp nicht den Mittelstreifen der Piste als Route vorgeschlagen. Als wir dann die Autobahn unterqueren, entdecken wir, dass sich dort unter den riesigen, kahlen Betonbögen Menschen niedergelassen haben. Dort steht eine Bretterbude. Der Schornstein qualmt gemütlich, es gibt einen kleinen Verschlag für Tiere. Weiter geht es entlang der Bahnstrecke und dann endlose Kilometer auf einer mittelmäßig befahrenen Karlsbader Einfallstraße, gesäumt von Eigenheimen in muffiger Vorortarchitektur. Wie schon gesagt, es ist grau, es ist kalt, es ist windig. Es gibt wenig Grün, jede Menge Lärm und keinerlei erhabene An- oder Ausblicke. Aber was klingt wie Tristesse, ist es nicht. Es ist die Realität, es ist eine Wahrheit unserer Zivilisation und sie gehört dazu. Was wären wir für Reisende, pickten wir uns nur die Rosinen aus dem Kuchen.
Wir haben Zeit, ein wenig zurückzuschauen. Ostrov – Schlackenwerth, was wissen wir darüber? Eine Stadt mit zwei Gesichtern. Nein, zwei Städte eigentlich. Der alte, historische Teil ist ein beschaulicher Marktplatz, um den sich windschiefe, mittelalterliche Häuser drängeln. Ein Schloss, ein Park. Nach 1945 wurde eine neue, eine zweite Stadt errichtet, in der mehr Menschen wohnen als im alten Teil. Eine Planstadt nach demselben Prinzip wie Eisenhüttenstadt. Es entstand eine stalinistische Musterstadt im Sozialistischen Klassizismus mit Boulevards und großen Plätzen. Am zentralen Platz des Friedens wurde ein großes Kulturhaus mit Theater-, Kinosaal und Luftschutzbunker errichtet. Mehrere Schulen und drei Gesundheitsstationen entstanden.
Wir sind gestern Abend spät noch dorthin gegangen. Es ist gleichermaßen beeindruckend wie bedrückend. Warum das Ganze, warum investierte die Sowjetunion derartig in so ein kleines Kaff in Nordwestböhmen? Die Antwort ist einfach und liegt ein paar Kilometer weiter talaufwärts. In Joachimsthal wurde Uran für das sowjetische Atomwaffenprogramm abgebaut. Das Grubengebiet von Jáchymov wurde zum Sperrgebiet erklärt. Als Arbeitskräfte dienten Zwangsarbeiter. Zur Unterbringung dieser Arbeiter wurden im Gebiet mehrere tschechoslowakische Gulags errichtet. Mit knapp 50.000, darunter über 10.000 politischen Häftlingen, erreichten die 18 Lager um 1955 ihre höchste Belegungszahl. Insgesamt durchliefen die Lager rund 100.000 politische Häftlinge und über 250.000 Zwangsverpflichtete. Vermutlich hat etwa die Hälfte von ihnen die Bergarbeit nicht überlebt. 1964 wurde der Uranabbau eingestellt.
Gestern haben wir in Joachimsthal im Kurpark auf einer Bank gesessen. Die Sonne schien uns warm ins Gesicht, wir teilten uns einen Apfel und bewunderten die mondänen Häuser und Villen in opulenter Bäderarchitektur. Da haben wir das alles noch nicht gewusst.
Kurz vor Karlsbad verlassen wir endlich diese unsägliche Straße und folgen einem kleinen Bächlein. Es wird dörflich, grüner und stiller. Wir machen Bekanntschaft mit dem gemeinen tschechischen Hofhund. Hinter jedem zweiten Zaun lebt so ein zotteliger Vierbeiner, der treu und brav seine Arbeit tut. Der eine mehr, der andere weniger. Es geht um die Einschüchterung der Passanten. Manche heben nur träge den Kopf und machen … wuff. Andere gebärden sich wie wild, als wollten sie über den Zaun und einem an die Kehle springen (was sie in Wirklichkeit ja gar nicht wollen, sie wollen ja nur spielen). Es wird immer städtischer. Die Häuser größer, die Kläffer weniger. Wir nähern uns unserem Ziel. Noch einmal geht es steil hinauf, an einem Schlösschen vorbei, durch einen schönen Park. Und dann wird die Sicht frei. Zu unseren Füßen liegt Karlsbad. Einer der mondänsten und weltweit bekanntesten Kurorte. Besucht von den namhaftesten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Mein inneres Orchester spielt einen Tusch.
Etwa eine Stunde später sitzen wir in einem kleinen Café in der Innenstadt. Es ist gerade 14 Uhr. Draußen prasselt der Regen, der Wind rüttelt an den Ästen der Bäume und ab und zu donnert es. Wir trinken schon den zweiten Grog und essen frische warme Karlsbader Oblaten. In dieser Stadt rasten wir, gönnen uns einen freien Tag. Wie gut es uns geht.

10.04.2023
14. Etappe
Von Oberwiesenthal nach Ostrov

Der Tag beginnt heiter und beschwingt mit einem Lied.
Es kam Robert schon vor einigen Tagen in den Sinn und nun hat er es bei Youtube gefunden. „Nach Süden“ von Lift.
Ein kleiner Junge träumt vom Reisen:
„Fliegen nach Süden
Um immer die Sonne zu sehn“ …
„Nach Süden, nach Süden
Wollte ich fliegen
Das war mein allerschönster Traum.“
Er kommt nicht weit, es bleibt bei einer unerfüllten Sehnsucht. Die Tonart, in der das Lied klingt, ist ein trauriges Moll.
„Mensch Robert und wir?“
Wir laufen seit Tagen in den Süden, immer der Sonne entgegen (wenn sie denn mal scheint). Unser Traum verwandelt sich schrittweise in Realität. Unser Lied steht in Dur.
Versonnen stehe ich mit meiner zweiten Tasse Kaffee am Fenster. Was für ein schöner Blick. Auf der rechten Seite der Fichtelberg (1215 m) auf der linken Seite, sein etwas größerer Bruder, der Keilberg (1244 m). Dort liegt noch Schnee und die Lifte sind in Betrieb. Ja und irgendwo dazwischen müssen wir heute durch. Wir wollen ja schließlich auf die andere Seite. Ich starre in das Tannengrün. Einen Weg erkenne ich nicht. Robert drängelt, wir machen uns auf die Socke.
Von den 470 für heute angekündigten Höhenmetern erledigen wir 400 in der ersten Stunde. Steil, steil geht es hinauf. Ich steige langsam, bloß nicht aus der Puste kommen. Immer im gleichen Rhythmus setze ich die Füße. Wird es steiler, setze ich die Schritte enger, entspannt sich die Situation, schreite ich großzügiger aus. Mein Blick tastet den Boden vor mir ab. Wohin setze ich den nächsten Schritt, den übernächsten. Erwartet mich ein weiches Stück Moos, ein wackeliger Stein oder ein Flecken brauner, rutschiger Erde? Ich liebe es. Kurz vor Erreichen der Waldkante bleiben wir stehen und schauen zurück. Was für ein Blick. Weit unter uns der Wiesenthaler Pass. Er ist der höchstgelegene der 13 Erzgebirgspässe und führt über den Sattel zwischen den beiden Riesen dieser 570 Millionen Jahre alten Gebirgsformation. Heute ist er den Autos vorbehalten und ganzjährig befahrbar. Das war nicht immer so.
Die Geschichte dieser Pässe beginnt im 12. Jahrhundert mit der damals einsetzenden dichten Besiedelung des Gebirges. Die ersten Handelsrouten waren Salzstrassen. Böhmen und den weiter südlich liegenden Donauländern fehlte Salz als einheimischer Rohstoff völlig. Es hatte eine große Bedeutung für die Haltbarmachung von Nahrungsmitteln. Später kamen Bergbauprodukte und Fernhandelsgüter wie Wein, Felle, Fisch, Tücher etc. dazu. Man brachte sie in die überregional bedeutsamen Messe- und Handelsplätze, wie z.B. Leipzig. In der Mitte des 15. Jahrhunderts erscheint eine erste Landkarte, in der diese Handelsrouten eingezeichnet sind. Na die hätten wir ja zu gerne im Antiquariat. Ab dem 15. Jarhundert kommt dann das Post- und Botenwesen dazu. Erst vorgestern in Schlettau bestaunten wir eine recht große, viereckige kursächsische Postmeilensäule, auf der die Entfernungen zwischen den Orten eingraviert sind. 56 Stunden brauchte man damals von Schlettau nach Berlin. Respekt.
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts waren die Straßen und Pässe in einem erbärmlichen Zustand. Ausgefahrene und schlecht befestigte Wege, auf denen bei schlechtem Wetter oder steilen Passagen oft kein Durchkommen war. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts trieben Räuberbanden, Schmuggler und Wegelagerer, im Schutze der dichten, undurchdringlichen Kammwälder ihr Unwesen. Das war damals ein echtes Problem und zahlreiche Verordnungen wurden erlassen, um dem grausigen Tun Einhalt zu gebieten.
Meine Gedanken kehren zurück. Ich schaue auf das gewundene Passträßlein, auf dem die Autos flink emporkrabbeln wie kleine, bunte Käfer.
Heute sind die Straßen und Wege tiptop und kein Mensch braucht sich vor Räubern zu fürchten. Das ist gut so.
Wir wenden uns wieder dem Berg zu, steigen schweigend und gemächlich weiter. Der Wald nimmt uns unter sein grünes Dach.
Die angekündigten 900 m Abstieg erweisen sich zunächst als ein Problem. Irgendwie verlaufen wir uns. Der Weg, zunächst klar definiert, wurde immer schmaler und verlor sich schließlich im Gestrüpp einer Fichtenschonung. Wir stehen vor einem Abhang mit geschätzten 45 Prozent Gefälle. Und nur Bäume und Gestrüpp. Ganz tief unten im Tal sehen wir die Skiliftanlagen von Joachimsthal. Zurück wollen wir nicht, da müssten wir ja wieder hoch. Also runter da. Querwaldein. Schon nach wenigen Metern zittern mir die Knie vor Anstrengung. Gestrüpp zerrt an den Hosenbeinen. Immer wieder plumpsen wir auf unseren Allerwertesten. Mann oh Mann, das ist ein Ritt. Das hatte ich mir einfacher vorgestellt. In Joachimsthal ist die Welt wieder in Ordnung. Die letzten 8 km kullern wir wie Murmeln auf einer Bahn, den leicht geschwungenen und dezent abschüssigen Mühlensteig hinab. Wir rollen bis fast vor die Haustür unserer Pension. Durchschnittsgeschwindigkeit 5 km pro Stunde. Unser persönlicher Rekord.
Für Morgen ist sehr wechselhaftes Wetter angesagt. Wir gehen direkt und ohne Schnörkel nach Karlsbad. Das sind nur 12 km und keine nennenswerten Höhenunterschiede. Wir haben uns ein schönes Zimmer mitten im Zentrum gemietet. Wir haben gleich zwei Nächte gebucht. Ein Ruhetag steht an. Ich kann ihn gut gebrauchen und freue mich darauf. Eins habe ich mir allerdings vorgenommen. In Karlovy Vary gehe ich in die SpoWa und kaufe Robert eine neue Jacke. Mit dem Brandloch auf dem Rücken… das ist ja unmöglich.

09.04.2023
13. Etappe
Von Schlettau nach Oberwiesenthal

Heute ist sie da. Sitzt frech auf meiner Bettkante und grinst mir fies ins Gesicht. Die erste handfeste Krise. Unwirsch stehe ich auf und versuche meine schlechte Laune an Robert auszulassen. „Immer muss ich hier alles alleine machen… und Du lässt Dich von hinten bis vorne bedienen... Rhhhh. Du bist so bequem.“ Er sitzt nur da, mümmelt sein Wurstbrötchen und grinst leicht in sich hinein. Das macht die Sache nicht besser. Ich weiß auch nicht so recht, was los ist heute. Eigentlich läuft alles super. Super super sogar. Nach der Euphorie der letzten Tage macht sich in mir eine gewisse Erschöpfung breit. Bis nach Mitternacht habe ich noch Karten studiert auf der Suche nach der schönsten Route mit den preiswertesten Übernachtungen. Habe die nächsten, übergeordneten Ziele festgelegt. Habe die Unmengen von Kilometern vor mir gesehen, habe gehadert. Jeder Tag fordert die vollste Aufmerksamkeit. Die Tour planen, gehen, erleben, verstehen, gedanklich aufarbeiten. Selbst die schnöde Versorgung mit Lebensmitteln nimmt einen großen Raum ein. Welche preiswerten gesunden Gerichte kochen wir in einer schlecht ausgestatteten Ferienwohnungsküche? Wir werden ein Kochbuch schreiben. Heute Abend möchte ich zur nächsten Vorstandssitzung des Fliegervereins einladen und ich werde mit Jakob telefonieren. Ich habe Angst, den Anschluss zu verlieren. Ich hänge sehr an meinen Leuten zu Hause. Zu sehr. Es fällt mir schwer, mich zu lösen. Mich dem Lauf der Dinge anzuvertrauen.
Ich mache Bekanntschaft mit der Aufgabe hinter der Aufgabe.
Der Weg, den wir heute gehen, ist bestens geeignet, sich damit zu beschäftigen. Anfangs folgen wir einer recht interessanten ehemaligen Eisenbahnstrecke von Schlettau nach Crottendorf. Dann geht es ab in den dunklen Nadelwald. Auf schnurgeraden, steilen asphaltierten Forstwegen nähern wir uns dem Fichtelberg. Gipfelsturm auf den 1215 m hohen Riesen der ehemaligen DDR. 40 Jahre lang war er das höchste der Gefühle.
Unterwegs werden wir angequatscht von einem schwatzhaften Radfahrer. Wo wir denn hinwollten mit unseren Rucksäcken und ob da ein Zelt drin wäre. Die Antwort interessiert ihn nur wenig. Im kleinsten Gang demmelt er neben uns her und schwadroniert in feinstem Erzgebirgisch über Gott und die Welt. Er fährt gerne Ski und als er erzählt, dass die Nordseite des Keilberges fast immer bis zum Geburtstag des Führers schneesicher ist, werde ich etwas kurzatmig. Er lebt alleine, seine Freundin ist ihm weggelaufen in Coronazeiten. Er ist wohl einsam. Was ich nicht schaffe, gelingt schließlich Robert. Kurz vor der steilsten Steigung schütteln wir ihn ab. Wir sind wieder alleine. Ich denke laut nach und Robert ist ein geduldiger Zuhörer.
Gegen 14 Uhr nähern wir uns Oberwiesenthal. Dem Wintersportmekka Ostdeutschlands.
Die höchstgelegenste Stadt Deutschlands ist Olympiastützpunkt und Bundesleistungszentrum für Wintersportler. Aber auch der gemeine Schneesportbegeisterte kommt hier auf seine Kosten. Die großen steilen Schneisen im Wald, die nun ruhenden Skilifte und Schneekanonen und die wackeligen kleinen Buden für den Apré-Ski-Gaudi zeugen davon. Für mich ist das nichts. Ich habe es ein paar mal versucht. Bin auch schon die schwarze Piste des Fichtelberges runter gegurkt. Es ist gut so. Ich würde es schwer mit meinem ökologischen Gewissen überein bringen. So habe ich eine Sorge weniger. Während ich an der imposanten Schanze vorübergehe, krame ich in meinem Gedächtnis. Was fällt mir dazu denn ein … ahh richtig. Jens Weißflog, der Floh vom Fichtelberg. Ich erinner' mich, es muss '84 gewesen sein … Winterolympiade in Sarajevo … gespannt wie die Flitzebogen saß die ganze Familie vor dem Fernseher. Jens Weißflog holte für uns Gold. Sein größter Konkurrent war der Finne Matti Nykänen. Das waren Zeiten. Heute betreibt Jens gemeinsam mit seiner Frau ein familienfreundliches Hotel in Oberwiesenthal. Wir sehen, dass ein Wanderweg den Namen Viola Bauer trägt. Wir überlegen. Ein Bratschenbauerweg ist das bestimmt nicht. Wir werden unseren Wintersportexperten Mö befragen. Wer war Viola Bauer?
Wir haben wieder ein schönes Quartier gefunden. Es ist nun das 15. zu Hause auf Zeit. Morgen verlassen wir Deutschland.

08.04.2023
12. Etappe
Von Thum nach Schlettau

Der morgendliche Blick aus dem Fenster lässt uns wieder in die Kissen fallen. Nebel, Nieselregen, nasskalt. Das Thermometer zeigt 1° über Null. So ein Sauwetter, da jagt man ja keinen Hund vor die Tür. Wir bleiben einfach noch eine Stunde im warmen Bett. Als wir gegen halb elf losziehen, kann man immerhin schon wieder die steile Wiese hinter dem Dorf und den Waldrand dahinter sehen.
Zunächst geht es bergauf und schon scheint die Angst zu frieren völlig absurd. Wir haben alles angezogen, was wir haben, und schwitzen nun ordentlich. Es ist wunderschön im Wald. Es ist ein buckeliger Fichtenwald mit weit auseinanderstehenden Bäumen. Der Waldboden und die herausschauenden Wurzeln der Bäume sind mit grünem Moos überzogen. Die Stämme sind fast schwarz, verlieren sich zunehmend im Nebel, werden immer schemenhafter. Hier und da gibt es Reste von Schnee. Es duftet ganz wunderbar. Ein bisschen harzig, ein bisschen nach Nadeln, ein bisschen modrig. So eine Mischung aus Fichtennadelschaumbad und nassem Handtuch. Als dann die großen Greifensteine im Wald auftauchen, fällt mir nur noch der Begriff „mystisch“ ein. Wenig später machen wir Bekanntschaft mit einer nächsten Blüte der Zivilisation, die allerdings um einiges älter ist als die Fabriken des großen Zeitalters der Industrialisierung. Es ist der Bergbau. Schon ab dem 14. Jahrhundert wurde hier gegraben, gebohrt und geschürft, um dem Berg wertvolle Metalle zu entreißen. Die Objekte der Begierde hießen vorrangig Silber und Zinn. Auch dabei kam es schon zu großen Einflussnahmen in den natürlichen Lauf der Dinge. Unser Weg folgt nun einem künstlich angelegten Wasserlauf. Dem Röhrgraben. Er verband einst die nun stillgelegten Stollen. Direkt vor den Stollen wurden ab dem 14. Jahrhundert Pochwerke installiert, welche das zu Tage geförderte Gestein zerkleinerten. Diese wurden mit Wasserkraft angetrieben. Zudem trennten invalide Männer, Kinder und Frauen mit kleinen Hämmern das wertvolle vom unbrauchbaren Gestein. Was muss ein Gehämmer durch den Wald gedröhnt haben. Heute ist es alleine der Specht, der klopft.
Kurz vor Tannenberg erwartet uns eine böse Überraschung. Wo bisher unser Fuß weich über mit Nadeln und Moos bedeckten Waldwege spazierte, stehen wir nun vor einer auf 3m Breite tiefenzerstörten Schlammwüste.
Eine Schneise der Verwüstung. Das grausame Werk eines Harvesters, welcher hier sein Unwesen trieb. Der Wald drumherum sieht aus wie nach einem Artilleriebeschuss bei Verdun im Jahr 1918. Der Feind hier ist allerdings der Borkenkäfer. Die Frage bleibt, wer Freund - wer Feind. Die Alternative, ein gesunder Wald und ein paar gutmütige, dickärschige Rückepferde, scheint Lichtjahre entfernt. Wütend stolpere ich durch die Matsche, die kein Ende nehmen will. Wütend auf wen? Auf den Harvester? Kaum. Auf den Arbeiter, der am Morgen mit Brotbüchse und Thermoskanne die Kabine dieses Monsters besteigt, um seiner zugewiesenen Lohnarbeit nachzugehen? Das wäre nicht richtig. Auf die Waldbesitzer, die durch intensive und auf Profit orientierte Forstwirtschaft den Wald ausbeuten nach Strich und Faden? Vielleicht. Auf uns Menschen in unserer grenzenlosen Gier nach Rohstoffen? Jetzt komme ich der Sache näher. Mist, jetzt bin ich auch noch wütend auf mich selbst.
Und munter murmelt neben mir der Greifenbach und kann mich nur schwer besänftigen. Irgendwann ist der Spuk vorüber. Ein bitterer Geschmack bleibt. Ein warmer Kaffee und ein Windbeutel in der Bäckerei von Tannenberg trösten.
Die letzten sechs Kilometer sind wieder ein Fest. Wir sind zurück auf dem Zschopautalweg. Von Bäumen, Laternen und Zäunen grüßt die lieb gewonnene rot-weiße Wegmarkierung. Es geht hinauf und hinunter über grüne Wiesen und durch scheinbar intakte Wälder. Der Fluss, dem wir vor zwei Tagen gefolgt sind, ist ein Flüsschen geworden. Ganz schmal. Wir nähern uns seiner Quelle. Noch ein Tagesmarsch bis zum Kamm des Erzgebirges. Danach geht es nur noch bergab. Glauben wir wenigstens. Der Turm des 600 Jahre alten Schlosses Schlettau grüßt. Bald haben wir es geschafft.
Heute sind wir 18 km gelaufen. Es war ein Pappenstiel.

07.04.2023
11. Etappe
Von Zschopau nach Thum

Heute gehen wir nach Thum. Und das wissen wir schon seit gestern Abend. Wir verlassen den Zschopautalwanderweg und steigen das Tal der Willisch hinauf.
Der Morgen beginnt heiter. Gegen 8 beugt sich Robert über mich und weckt mich mit dem Kalauer: „Will isch oder will isch nicht.“ Er erntet ein Augenrollen. Kichernd hüpfe ich aus dem Bett und mache uns einen Kaffee.
10 vor 10 stehen wir vor dem Dicken Heinrich, so heißt der große Turm im Schloss Wildeck in Zschopau und begehren Einlass. Wir wollen in die Motorradausstellung. Zschopau ist Motorradstadt und Heimat des legendären DKW-Werkes.
Schloss Wildeck ist eine mittelalterliche Burg und das Sammelsurium an „Feuerstühlen“, welche DKW über mehr als 100 Jahren fabriziert hat, wirkt etwas deplaziert. Aber egal. Die Motorräder sind wunderschön. Wir wandern durch die Jahrzehnte. Vom fahrradähnlichen Gebilde mit Hilfsmotor über 500 ccm Maschinen aus den 30er, wo schon mal locker 140 auf dem Tachometer stand, bis hin zur allseits bekannten und beliebten und unvergessenen MZ, liebevoll „Emme“ genannt. Alle flüstern mir zu: „Nimm mich mit, nimm mich mit, nimm mich mit.“ Im dritten Raum links hinten in der Ecke steht eine BK mit Seitenwagen… wir schauen uns verschwörerisch in die Augen und wortlos ist der Plan geschmiedet. Ich werde die Museumsaufsicht in ein Gespräch verwickeln. Robert schiebt das Motorrad samt Seitenwagen aus dem Museum. Wenn es sein muss hochkant und dann geht es ab nach Griechenland. Die Rucksäcke im Seitenwagen. Irgendwie haben wir dann doch versagt und lieber einen Kakao im Museumskaffee getrunken. Auf dem Weg nach Thum kommen wir am Motorradwerk vorbei, welches mit dem Ende der DDR auch recht bald aufgehört hat, Motorräder zu produzieren. Es ist kein Wunder, dass es so kam. Der große Erfolg dieser Firma bestand in den Anfangszeiten aus der Kombination eines cleveren dänischen Geschäftsmannes, eines klugen Ingenieurs und eines schillernden Verkaufsstrategen. Und der Idee, ein preiswertes, wartungsarmes Fortbewegungsmittel für den kleinen Mann zu entwickeln. Genau diese Idee funktionierte auch ausgezeichnet in der DDR, wo man bekanntlicherweise Jahrzehnte auf ein Auto warten musste. Ein Motorrad war da einfacher zu bekommen. Dann kam die Wende und die Ex-DDR wurde mit ausrangierten bundesdeutschen Schrottkarren überschwemmt. Emme, Simme und Co. hatten ausgedient. Heute werden Motorräder nur noch von Männern Ü60 mit Schmerbauch und abgeschlossener Vermögensbildung gefahren. Und Simme fahren? Das ist Kult. Aber keiner von den Hipstern fährt damit im Winter, um sechs Uhr morgens, mit Spritzdecke auf den Beinen zur Schicht. Sei´s drum.
Unser Weg nach Thum ist eine Überraschung. Was wir gestern an Industrialisierung an der Zschopau erleben durften, kulminiert in diesem kleinen, viel schmaleren Tal. Papierfabrik, Spinnerei, Kalkbrennerei, Leinenweberei. Lauter Ruinen und vergessene Schornsteine auf dem Grund eines dunklen, engen, felsigen Tales. Unser Weg läuft auf dem Damm einer Schmalspurbahn, welche in den 90ern final stillgelegt wurde. Tafeln informieren über Haltepunkte, Weichenstellungen, Verzweigungen in die Fabriken. Menschenmassen müssen sich über diese Bahn in das Tal ergossen haben. Der Fahrplan orientierte sich am Schichtwechsel. Und wir? Wir laufen und laufen und sehen kaum einen Menschen.
In der Herberge angekommen, entpuppt sich die freundliche Wirtin als Patin des Thumer Gastronomiekartells. „Wenn wir Hunger hätten“... ja haben wir, heute ist Karfreitag und alle Läden sind zu „dann könnten wir in IHREN Ratskeller gehen“. Was meint sie wohl mit „IHREN“? Ihrer großen Tochter gehöre der Laden, ihre Kleine arbeitet in der Küche, sie selber habe auch in der Gastronomie gearbeitet, jetzt sei sie zu alt. Heute wäre zwar alles voll, aber sie würde anrufen und uns anmelden und dann bräuchten wir nur zu sagen, dass wir aus dem „grünen Haus kämen“. So heißt unsere Pension und so sieht sie von außen auch aus.
Gut. Wir gehen also in den Ratskeller. Es ist brechend voll und wir flüstern der Kellnerin die Parole „grünes Haus“ ins Ohr und schwupp haben wir einen Tisch. Da sitzen wir nun und sitzen und sitzen und die Parole nützt uns nicht die Bohne. Der kleine Aushilfskellner nimmt unsere Essensbestellung zwar entgegen, wiederholt sie auch brav... und vergisst sie sofort. Da rein, da raus. Das kennt er aus der Schule. Er ist höchstens 16. Wenigstens die Nummer mit den Getränken klappt. Nach einer Stunde werden wir maulig und fragen bei der zweiten Kellnerin nach. Auch sie ist eine Aushilfe, arbeitet eigentlich im Trockenbau. Jedes zweite Wochenende hilft sie aus, wenn ihre Kinder Papawochenende haben. Sie schiebt alles auf den Knaben. Wir nehmen ihn in Schutz. Immerhin kommt dann auch unser Essen. Wurde auch Zeit, ich bin schon ganz betrunken. „Lass uns nach Hause gehen, Robert“, sage ich. Und auf dem Heimweg durch Thum hake ich mich unter.

06.04.2023
10. Etappe
Von Lichtenwalde nach Zschopau

Das Hotel „Schloss Lichtenwalde“ erwies sich als ein guter Ort. Eigentlich ein modernes, gesichtsloses 4-Sterne-Hotel. Das Interieur teuer aber lieblos, das Personal überfreundlich und servil. Der Gesamteindruck - Uniformierung auf hohem Niveau.
Aber – es war unschlagbar günstig und wir wissen selber nicht warum. Unser Zimmer hatte ein riesengroßes Panoramafenster mit Blick auf eine große Wiese und wir konnten unter diversen Vergnügungen wählen. Im Preis von 64 Euro für ein Doppelzimmer war enthalten: der Wellnessbereich (haben wir abgewählt), der Fitnessbereich (nein Danke), die Tischtennisplatte (da konnten wir nicht widerstehen). Wir spielten ein paar Spiele und ich habe Robert gewinnen lassen. Nach der Tischkickerschmach in Dessau geht es hier um Gesichtswahrung.
Beim Morgenkaffee im Foyer sind wir einsilbig. 25 km Fußmarsch liegen vor uns. Was für andere ein Spaziergang, ist für uns kein Pappenstiel. Wird schon werden! Das Wetter ist gut und wenn wir nicht weiterkommen, nehmen wir den Zug. Wir schmieden einen Marschplan und verabreden alle zwei Stunden eine längere Pause. Wir schauen in die Karte. Frühstück in Flöha und Kaffeepause in Hennersdorf.
Vom ersten Schritt an sind wir verzaubert. Immer wieder neue Blicke auf den Fluss bringen uns ins Staunen. Mal laufen wir wenige Meter vom Ufer entfernt. Mal sehen wir ihn nur aus der Ferne, beim Überqueren einer sanft ansteigenden Wiese. Mal laufen wir in der 3. Etage (ganz unten der Fluss, steil darüber die Eisenbahn und ganz oben wir).
Frühstück in Flöha. Eine merkwürdige Stadt und exemplarisch für die ganze Gegend um Chemnitz und exemplarisch auch für alles, was sich entlang der Zschopau abspielte. Wir finden keinen Marktplatz, kein Zentrum, keine Kirche. Flöha war bis Mitte des 19. Jahrhunderts ein Dorf, von Landwirtschaft geprägt. Mit der Industrialisierung siedelten sich hier große Baumwollspinnereien an. In Rekordzeit wurde eine Eisenbahn gebaut und andere zogen nach. Energielieferant und Quelle des Erfolges war der Fluss.
Ausgebeutet haben wir ihn. Wehr reiht sich an Wehr. Mühlgräben ziehen Wasser. Fabrik folgt auf Fabrik und dann gleich wieder ein Kraftwerk. Wir bestaunen imposante Industriedenkmäler aus dem vorletzten Jahrhundert. Sie machen uns nachdenklich. Baumwollspinnerein, Papierfabriken, Färbereien. Jeder nahm Wasser, jeder nahm Energie und gab dem Spender Abwässer in allen Farben zurück. Arme, arme Zschopau. Nach 1990 wurde es besser. Die größten Dreckschleudern wurden abgewickelt. Kläranlagen gebaut. Im Tal wurde es stiller. Man kann wieder in der Zschopau baden. Aus Gründen der Kulanz baute man Fischtreppen. Da stehen wir nun und starren in dieses brodelnde Menschenwerk zum Wohl des Fisches und fragen uns: Wird hier je ein dicker Karpfen hoch kommen?
Gegen Mittag bekommen wir einen Anruf. Es ist Ronny, der Vermieter unserer Ferienwohnung in Zschopau. Der Empfang ist schlecht. Wann wir denn kämen und wann wir wieder abreisen und wir sollen bloß aufpassen, dass wir nicht die falsche Adresse ins Navi eingeben, das ist schon öfter passiert. Ich bringe in Erfahrung, dass es eine Küche mit allem Pipapo gibt. Sogar einen Backofen. Die nächsten Minuten fantasiere ich laut vor mich hin: „Heute Abend, da kaufe ich mir eine Pizza bei Aldi und dann belege ich sie mit extra Zutaten. Tomaten und Mozzarella vielleicht. Robert, was legst Du extra drauf?“ „Bockwurst“, knurrt es neben mir. Na das wird ein Schmaus. Warum denke ich denn die ganze Zeit ans Essen? Wir haben doch gerade gefrühstückt.
Nach 25 km und 8 Stunden erreichen wir die Motorradstadt. Kurz vor dem Ziel ging es nochmal so richtig steil bergauf. Wir haben die Srecke gut gemeistert, haben nicht den Zug genommen und sind auch nicht auf allen Vieren durchs Stadttor gekrochen. Aber ganz ehrlich… jeden Tag müssen wir das nicht haben.

05.04.2023
9. Etappe
Von Mittweida nach Lichtenwalde

Mal wieder beendet ein Presslufthammer die Nacht. Ein ganz kleiner wahrscheinlich, aber in der Frühe wirken diese Geräusche anders. Die Handwerker haben ihr Tagwerk begonnen.
Wir zögern den Abschied hinaus. Von nun an gehen wir zu Fuß nach Griechenland. Die Räder stehen im Keller und werden ein Jahr ohne uns auskommen müssen.
Alte Witze werden gerissen. „Zu Fuss nach Griechenland?“ „Bis Frankenberg geht’s gut, danach ziehts sich.“ Die erfreuliche Tatsache des Tages: Wir haben unseren Rucksack gewogen. Jeder von uns trägt ca. 6 kg auf dem Rücken. Essen ist noch nicht drin. Brauchen wir auch erst einmal nicht. Schließlich haben wir gut gefrühstückt und wenn wir unterwegs Hunger kriegen, fangen wir uns einen Fisch in der Zschopau. Diesem wunderbaren Fluss folgen wir nämlich die nächsten Tage. Bis an seine Quelle nach Oberwiesenthal.
Wir verlassen Mittweida und schon auf den ersten Metern scheitert unser großer Plan, Hand in Hand nach Griechenland zu gehen. Fotos müssen gemacht werden, wir winken den Zurückbleibenden lange...
Schön ist es, zu Fuß unterwegs zu sein. Wir laufen über weichen Waldboden und Wurzeln. Ganz dicht neben uns murmelt der Fluss. Immer wieder bleiben wir stehen, schauen uns um, reden leise. Kein Auto, kein Fahrrad, kein Mensch. Es ist die schönste Zeit im Wald, wenn die Baumkrone noch nicht geschlossen ist und der Boden im schönsten, hellsten Grün leuchtet und übersät ist mit kleinen Blüten.
In Sachsenburg treffen wir auf traurige Geschichte. In einer Spinnerei entsteht 1933 eines der frühen nationalsozialistischen Konzentrationslager.
Das Lager gilt als Bindeglied zwischen den frühen Konzentrationslagern und dem späteren KZ-System, sowie als Experimentierfeld und Ausbildungsstätte der Lager-SS. Bis zu 10.000 Häftlinge hatte man hier untergebracht. Ein Ort, an dem das systematische Quälen, Foltern und Töten eingeübt wurde.
In Frankenberg essen wir eine „Soli“ und buchen Quartier in Lichtenwalde. Wir erreichen unser Hotel gegen 15 Uhr.
Die abendliche Suche nach der nächsten Unterkunft erweist sich als schwierig. Was gut erreichbar ist, ist teuer. Preiswerteres zu weit. Wir machen einen Kompromiss. 25 km Wanderung nach Zschopau für 80 Euro. Uhhhh, das ist ganz schön weit.

04.04.2023
8. Etappe
Von Pötzschau nach Mittweida

Wie sehr unterscheidet sich unser letztes Quartier von den gesichtslosen Pensionen der letzten Tage. Wir kommen bei guten Bekannten unter. Erhalten ein warmes Bett, eine köstliche warme Mahlzeit und die ein oder andere gute Geschichte noch obendrauf. Wir essen von Tellern mit blauem Strohblumenmuster aus Kahla. Die kenne ich noch von früher. Mir ist heimelig und warm. Was sind wir für Glückspilze.
Nicht besonders früh brechen wir auf, zu unserer letzten Fahrradetappe. Gegen Abend wollen wir in Mittweida sein. Fahrradfahren auf Sächsisch ist ein anderer Schnack.
Es ist hügelig geworden. Ziemlich sogar. Die Dörfer kuscheln sich nun in grüne Senken oder prangen auf zugigen Kuppen. Dazwischen windet sich, kurvig geschwungen, ein Sträßchen. Die Gegend erscheint lieblicher, die Ortschaften wohlhabender. Dorfprägend ist der zweigeschossige Vierseithof. Die abgeschlossenen Höfe der einst wohlhabenden Bauern wirken wie kleine Festungen. Ich möchte wetten, dass das Herzstück und Zentrum dieser Höfe ein prächtiger Misthaufen war. Darauf ein bunter, krähender Hahn mit geschwollenem Kamm.
Zurück zum Fahrradfahren auf Sächsisch. Das geht so: Im Kriechgang den Berg hinauf schnaufen. Auf der anderen Seite mit holdrio und wehendem Haar den Berg runter rasen. Dann den Schwung mitnehmen, den richtigen Gang erwischen, um nach ein paar Metern wieder im Kriechgang zu landen. Bei 10 Prozent Steigung hört der Spaß auf. Bei 10 Prozent Gefälle wird es richtig lustig. Es gibt nur noch hoch oder runter. Das ewige Mecklenburger Geradeaus mit leichtem Gegenwind ist längst Geschichte.
Gegen Mittag kehren wir ein. Wir haben noch nicht gefrühstückt. Ein winziges Kaff mit einem geöffneten Landgasthaus. Das können wir kaum glauben, da müssen wir rein.
Wir setzen uns an einen Tisch in der Ecke und überlegen, was wir wohl essen könnten. Der etwas schmierige Wirt kommt zu uns und seine Speisekarte klingt so: „Es gibt nur een Gerischd, es gibt jeden Tach ein anneresch Gerischd“. Heute gibt es Gulasch. Mist, ich wollte mich doch vegetarisch ernähren. Morgen gibt es Spinat mit Ei. Ich versuche, ihm ein Käsebrot abzuschwatzen. Er bleibt hart. „Gäsebrod is keen rischtsches Middach.“ Heute gibt es nur Gulasch. Ich habe Knast und wir bestellen zwei Portionen davon.
Während wir auf das Essen warten, schauen wir uns um. Der Gastraum ist auch gleichzeitig der Saal mit Bühne und Bar. Wenige viereckige Tische mit Tischplatten aus Sprelacart stehen herum. Drumherum Stühle mit Beinen aus Stahlrohr und abgewetzten Sitzflächen. Das ist nicht der neueste steilste Vintage-Shabby-Chic-Style. Das ist echt. Das ist Original. Von der Decke baumeln noch ein paar Girlanden von der letzten Sause und in der Luft liegt der dezente Duft von verschüttetem Bier, Schnaps, kalten Zigaretten und Likör. Der recht typische Geruch nach Tanz- und Balzschweiß rundet das Odeur ab.
Der Wirt diskutiert am Nebentisch mit dem außer uns einzigen Gast die Lage der Nation:
„Aus´m Ugrainekriesch, da halten mir uns naus. Sonst gommt da noch ne dicke Mumpel (ugs. Granate, Bombe) geflochn un alles is bladd.“
Es ist wunderbar, es ist einmalig und das Essen den Umständen entsprechend. Beim Bezahlen erfahren wir noch, dass wir froh sein können, überhaupt etwas zwischen die Kiemen bekommen zu haben. Er ist der letzte der Gastwirte in der Gegend, der die Stellung hält. „Die Jungen gehen alle wech und machen Bardy.“ Was machen die? „Bardy machen die.“ Mein Blick geht hilfesuchend zu Robert: „Was machen die?“ „Barty eben, aber mit hartem B.“
Wir steigen wieder auf die Räder. Und ein paar kräftezehrende 10-prozentige später erreichen wir Mittweida. Nicht in der Wikipedia aufgeführte berühmte Kinder dieser Stadt: Robert Loest, Sohn von Erich Loest (Ehrenbürger der Stadt) und Annelies Richter, geboren ebenfalls in Mittweida. Die Hauptstrasse ist eine einzige Baustelle und die letzte Steigung, der steile Chemnitzer Berg, bringt die finale Zermürbung. Gut, dass es ab morgen zu Fuß weitergeht.
Wir werden herzlich empfangen von Sonja und Karl-Heinz. Sie gehören zur Familie und in ihrem Haus ist Robert groß geworden. Hier lebten seine Großeltern, bei denen er in seiner Kindheit viel Zeit verbrachte. Mittweida war ein Stück unbeschwerte Kindheit für ihn. Es ist schön für mich, diesen Ort und diese Menschen kennenzulernen. Abends sitzen wir im Wohnzimmer beisammen bei einer Flasche Wein. Wir führen ein schönes, unaufgeregtes Gespräch. Immer wieder turnt eine kleine Katze durch die Szenerie. Balanciert munter über die hohe Sofalehne, tut so als ob sie hinters Sofa abstürzt, taucht sofort wieder auf, kriecht in das schmale Fach unter dem Fernseher, saust wieder hinaus. Es ist Lissi. Sie wohnt hier auch.
Halb zwölf schauen wir erschrocken auf die Uhr. Wir müssen ins Bett. Morgen früh halb sieben kommen die Handwerker. Große Umbaumaßnahmen stehen an im Haus. Wir machen das Sofa zu einem Bett (hoffentlich hält es dieses Mal), bekommen ein paar Decken und legen uns schlafen. Noch im Halbschlaf spüre ich, wie sich kleine Pfoten ganz leicht und vorsichtig über meine Decke tasten. Ein kleines Wesen rollt sich in meinen Kniekehlen zusammen. „Schlaf gut, liebe Lissi“, sage ich leise und schlafe auch ein.
03.04.2023
Fast ein Ruhetag
Ich wache auf und in meinem Schädel grummelt es leise. Das letzte Glas Rotwein war dann doch zu viel. Egal, es war ein schöner Abend, sogar Schlager haben wir gehört. Heute Nacht ist unser Bett zusammengekracht. Während einer Tiefschlafphase… ehrlich. Die Reparatur im Dunkeln war ungenügend.
Später sitzen wir an einem reich gedeckten Frühstückstisch. Es gibt alles, was man sich vorstellen kann, und noch ein bisschen mehr. Dazu einen starken Kaffee. Wir reden von alten Zeiten. Wie schön, dass man gute Freunde hat.
Gegen halb elf verabschieden wir uns von Conny und Wolfgang und fahren durch die Leipziger Innenstadt zum Bahnhof. Wir wollen uns noch von Jakob verabschieden.
Wir sitzen in der großen Osthalle des Bahnhofs. Eine prächtige Halle. Es ist nur eine von zweien. Die symmetrische Aufteilung des Bahnhofes beruht auf der ursprünglich gemeinschaftlichen Nutzung von Preußischer und Sächsischer Staatsbahn. Wir als Sachsen sitzen natürlich im ehemalig sächsischen Teil. „Robert, Du weißt schon, dass ich kein Sachse bin?“
Es ist ein schöner Ort, ein prächtiger Ort und die Fantasie darf sich entfalten. Ich versetze mich in die Zeit vor über 100 Jahren. Dampflokomotiven schnaufen pfeifend und qualmend in den Kopfbahnhof. Männer im Gehrock und Frauen in langen, taillierten Kleidern stehen auf den Bahnsteigen. Riesige Wagen mit Koffern werden geschoben. Verölte Mechaniker prüfen Bremsen und entkoppeln die Waggons von der Lok.
Ich bringe Jakob noch bis zum Zug. Wir verabschieden uns ein zweites Mal. Es ist schon leichter. Wir sehen uns bestimmt bald wieder.
Heute ist ein Ruhetag. Sogar auf der Tour de France gibt es so einen. Ruhetag bedeutet auch Waschtag. Wir finden einen Waschsalon mit Café im Leipziger Westen. In Lindenau.
Da sitzen wir dann in Unterhose an einem kleinen Tischchen, trinken frischen Pfefferminztee und machen Homeoffice. Säumige Kunden wollen gemahnt werden.
Zwei Stunden später haben wir wieder eine Hose. Und zwar eine saubere.
Einen kleinen Weg von 25 km haben wir noch vor uns. Wir fahren nach Pötzschau südlich von Leipzig. Dort haben wir Quartier bei guten Bekannten.
Wir radeln durch die Leipziger Seenlandschaft. Einst grässliche Tagebaulöcher wurden zu einem attraktiven Erholungsort. Der Radweg verläuft mitunter dicht an den Rändern der Dörfer entlang. Er markiert die ehemalige Abbruchkante. Wäre die Wende drei Jahre später gekommen, gäbe es diese Dörfer nicht mehr. Schon im Heimatkundeunterricht wurde dem kleinen Robert erklärt, dass diese Tagebaue in absehbarer Zeit in blühende Seenlandschaften umgewandelt werden. In diesem Sinn ist die Zukunftsvision unseres kleinen sozialistischen Staates in Erfüllung gegangen. Zu bezweifeln ist, dass die DDR-Planwirtschaft den Kraftakt der Renaturierung hätte leisten können.

02.04.2023
7. Etappe
Von Bitterfeld nach Leipzig

Sonntagmorgen 8:00 Uhr. Das Thermometer zeigt 3 Grad. Fröstelnd und etwas unausgeschlafen steigen wir auf unsere Räder. Die ersten Meter sind schwer.
Wir verlassen Bitterfeld in Richtung Süden und fahren durch stillen Wald vorbei an Seen. Kein Mensch weit und breit. Es macht wieder Freude. Das Maschinchen ist warm gelaufen. Meine Gedanken kehren immer wieder zurück zum Bitterfeld von Gestern. Aus dem Dreckloch ist ein Naherholungsgebiet geworden. Hier scheint das Problem gelöst. Gelöst? Oder nur verschoben. An einen Ort, der zu weit weg ist, um Betroffenheit in uns zu erzeugen.
Nach einigen Kilometern säumen engmaschig Warnschilder unseren schmalen Weg. Betreten verboten, Lebensgefahr, Strafe, Militär, Bergbau. Die Wörter flitzen rechts und links an mir vorbei. Unwillkürlich ziehe ich die Schultern hoch, der Nacken wird steif und unser Weg verschmälert sich gefühlt auf Handtuchbreite. Da hilft auch das muntere Singen der Vögel nur wenig. Lange dauert es nicht, da ist der Spuk wieder vorbei.
Wir nähern uns nun Leipzig. Vor uns streben Flugzeuge wie auf einer Perlenschnur gefädelt in den Himmel, um alsbald in den Wolken zu verschwinden. Unser Navi leitet uns metergenau durch die unbekannten Gefilde. Was ist der Mensch für ein seltsames Wesen. Wie nah liegen Schöpferkraft und Zerstörungswut beieinander. Vielleicht liegt die Antwort in der Frage nach dem Antrieb. Wer bezahlt Forschung und was ist der Zweck, dem sie dient. Es ist an uns, einen guten Umgang mit den Errungenschaften unserer Zivilisation zu finden. Jeden Schritt gilt es abzuwägen.
Genug gegrübelt. Freudige Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Heute ist Familientreffen in Leipzig. Aus verschiedenen Himmelsrichtungen und in unterschiedlichem Tempo nähern wir uns der Stadt. Jakob kommt aus Schwerin, die Oma Birgit aus Erfurt und wir, wir kommen aus Bitterfeld. Treffpunkt ist der Leipziger Bahnhof um 12 Uhr. Matze wird uns abholen. Ich freue mich und trete kräftig in die Pedale. Es fühlt sich ein bisschen an wie nach Hause kommen.

01.04.2023
6. Etappe
Von Dessau nach Bitterfeld

Heute morgen war es gemütlich. Wir konnten ausschlafen. Unser erster Programmpunkt ist der Besuch des Bauhausmuseums. Das habe ich mir ausdrücklich gewünscht. Bauhaus - Avantgarde der Klassischen Moderne auf allen Gebieten der freien und angewandten Kunst und Architektur – dafür habe ich eine Schwäche.
Mitten in der Innenstadt, im Stadtpark, entstand 2019 das neue Museum.
Dieser schwebende Riegel aus Glas und Beton ist die zweitgrößte Sammlung zum Thema Bauhaus der Welt, die größte ist natürlich in unserer Hauptstadt und enthält 49000 Objekte. Sogar die Kanzlerin kam nach Dessau, um die Ausstellung einzuweihen.
Und dieser Tempel öffnet erst um 10:00 Uhr. Wir haben also Zeit.
Beim zweiten Kaffee in der Gemeinschaftsküche kommen wir ins Gespräch mit waschechten Dessauern. Zwei Frauen und ein Mann pellen in trauter Eintracht Unmengen von Eiern und füllen Marmelade in kleine Schälchen. Sie sind Angestellte der Herberge und bereiten den sonntäglichen Brunch vor. Sie interessieren sich nicht die Bohne für das Museum, waren auch noch nie drin und es gefällt ihnen auch nicht besonders. Früher war da der Park und das war auch gut so.
Ich bin begeistert von der Ausstellung. Die von den Bauhausmeistern und ihren Lehrlingen entworfenen Alltagsgegenstände sind von faszinierender Klarheit in der Form und berührend schön und seelenvoll. Mit allem haben sie sich befasst. Mit Tapeten, mit Teppichen, mit Geschirr, mit Möbeln, mit Photographie, mit Architektur, mit Typographie, mit Städteplanung, mit Lichtgestaltung, mit Malerei und und und. Und es gab immer den gedanklichen Überbau, in dem es um bessere Lebensbedingungen für die einfachen Menschen ging. Um neue Ideen des Zusammenlebens und um die Gleichberechtigung der Geschlechter. Ich fühle eine kleine Sehnsucht. Wie gerne wäre ich dabei gewesen. Schülerin am Bauhaus.
Gegen 13 Uhr verlassen wir Dessau. Wir folgen heute dem Mulderadweg. Es geht durch lichte Auenwälder, entlang grüner Deiche, wir bestaunen das neue Wehr von Raguhn. Das Wetter ist erstaunlich gut. Jeden Tag verändert sich die Landschaft, durch die wir fahren, und jeden Tag wird es ein bisschen mehr Frühling.
Wenige Kilometer vor Bitterfeld endet unser Weg an einem großen See und wird zu einer Promenade. Sie trägt den klangvollen Namen „Bernsteinpromenade“. Es ist eine Promenade, die ihren Namen verdient. Cafés, Restaurants, Attraktionen reihen sich aneinander und die Bevölkerung promeniert. Es ist schließlich Wochenende und die Sonne scheint. Der See glitzert, die Luft ist klar, die Farben der hübschen Kleider leuchten. In unserer Erinnerung bedeutet das Wort Bitterfeld etwas anderes. Wir versuchen uns zu erinnern, wir recherchieren. Und stoßen auf den Dokumentarfilm „Bitteres aus Bitterfeld“, der 1988 heimlich hier gedreht wurde.
Eingangsbilder zeigen die vom Braunkohle-Tagebau verwüstete Landschaft, hohe Fabrikschornsteine mit Abgasfahnen in verschiedenen Farben, einen Getreidespeicher vor einem Werk zur Chlor-Produktion sowie städtische Wohnstraßen mit grauen Fassaden und zerfallenden Gebäuden. Aus dem Off erläutert eine Sprecherin, dass in Bitterfeld etwa 2000 Produkte für Haushalt und Garten, Industrie und Landwirtschaft hergestellt würden, darunter Waschmittel und Kunststoffe, Farben und Dünger, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel. Die chemische Industrie entledige sich ihrer Abfälle durch Deponierung in den weitläufigen Gruben der Tagebaue, durch Einleitung in den Elbe-Zufluss Mulde und durch Abgabe an die Luft. Die Sprecherin kommentiert: „Bitterfeld zerfällt. Bitterfeld ist rußschwarz. Bitterfeld stinkt. Bitterfeld gilt heute als die schmutzigste Stadt Europas.“
Von all dem ist hier nichts mehr zu spüren. Rein gar nichts.
In der Wikipedia lesen wir über die berühmten Söhne und Töchter der Stadt und stellen mit Schrecken fest – einer fehlt. Unser lieber Freund Bernd Bombis,
berühmter Baggerfahrer und berüchtigter Segelflieger wurde hier geboren. Da müssen wir etwas unternehmen. Gleich morgen gehen wir ins Bürgermeisteramt und schlagen vor, die Bernsteinpromenade
umzubenennen. In Bombispromenade. Es wird nicht einfach werden. Er wird uns abspeisen wollen mit einem „Bombisgässchen“ im Industriepark. Aber da bleiben wir hart. Unsere Maximalforderung ist
schließlich, Bitterfeld in Bombisfeld umzubenennen. Da gibt es also Spielräume.

31.03.2023
5. Etappe
Von Burg nach Dessau

Heute ist die Stunde der Wahrheit. Die erste selbstgeplante Querfeldein-Tour. Keine Wegweiser, keine Entfernungsangaben, keine touristischen Höhepunkte. Wir kürzen pragmatisch den großen Bogen ab, den die Elbe westlich von uns zwischen Magdeburg und Dessau beschreibt.
Es ist eine durch und durch ehrliche Tour. Wir fahren neben tösenden Bundesstraßen und quälen uns gemeinsam mit schweren LKWs durch enge Kleinststädte ohne Umgehungsstraße. Wir radeln über kleine Straßen durch totenstille Ortschaften. Wir balancieren unsere Räder im Schritttempo über matschige Feldwege. Über uns der wolkenschwere Himmel, dem es nur selten gelingt, das Wasser zu behalten. Mütze und Handschuhe haben wir wieder herausgeholt. 9 Grad zeigt das Thermometer.
Alles ist gut, ist richtig, ist erfüllend. Wir frieren nicht, wir lassen den Blick schweifen, wir lachen über uns selber beim Eiertanz durch die Matsche. Wir haben Zeit, die Dinge, die wir sehen, zu hinterfragen. Was ist aus den Dörfern geworden? Allesamt prächtig mit großen dreiseitigen Höfen und riesigen Toreinfahrten. Einst war hier Leben, gab es mehrere Kneipen, eine LPG, Kinder in allen Altersklassen. Man lebte hier, man arbeitete hier. Die wenigsten hatten einen Fernseher. Heute sitzen die Alten hinter vergilbten Gardinen in einer Welt von gestern. Die jüngeren Leute kommen nur zum Schlafen nach Hause.
Vielleicht klingt es traurig. Ist es aber nicht. Es ist der Lauf der Dinge.
Wir fahren vorbei an einem Militärstützpunkt. Ich lese das Wort „Feldjäger“. „Robert, was sind Feldjäger?“ „Kettenhunde“ lautet seine Antwort. Die von allen Soldaten gefürchtete Militärpolizei. Die nächsten Kilometer träume ich meinen Traum von einer Welt ohne administrative Grenzen, in der eine Armee nicht mehr nötig ist. Nicht einmal zur Verteidigung. Ein paar Jährchen wird das wohl noch dauern.
Eine erste große Pause machen wir nach 40 km. Es ist so gar kein Picknickwetter, der Regen wird zornig und wir nehmen das erstbeste Café.
Es ist die traditionsreiche Schlosskonditorei in Zerbst. Hinter uns schließt sich die schwere messingfarbene Eingangstür und wir sind in einer anderen Welt. Wir haben bis jetzt noch nichts gegessen (es ist immerhin 14 Uhr) und schlagen über die Stränge. Jeder von uns bestellt sich zwei Getränke und zwei Kuchen. Es ist warm, wir sind satt. Leise Gespräche summen an den Nachbartischen. Eine Frau bestellt sich ein Kännchen Kaffee. Dezent klappert Geschirr im Hintergrund. Der ganze Plüsch und die Teppiche dämpfen die Geräusche. Meine Augen werden ganz schwer. Jetzt ein kleines Nickerchen – gleich hier, auf dem Sofa… lieber nicht. Wir fahren weiter. Dessau erreichen wir gegen halb sechs und die Sonne scheint.
Unser preiswertes Hostel entpuppt sich als wahrhafter Glücksgriff. Das Zimmer ist zwar klein, zum Schlafen aber völlig ausreichend. Beiwerk: Gemeinschaftsraum mit Tischkicker. Diesen nehmen wir sofort in Beschlag und Martina zeigt mir, wo der Frosch die Locken hat. Ich lasse mir meine Enttäuschung nicht anmerken. Weiterhin gibt es eine große Gemeinschaftsküche mit allem Drum und Dran.
Es gibt blitzblanke Duschen, Toiletten und im Foyer eine Bar. Dort könnte man Freundschaften schließen. Zusammen wohnt es sich besser als allein.

30.03.2023
4. Etappe
Von Tangermünde nach Burg

Als wir heute morgen in unserem Bett… „Wo sind wir heute morgen aufgewacht Robert?“ „Tangermünde“, knurrt es neben mir – ach ja Tangermünde… wie auch immer… wir hatten einen Plan. Einen mächtig gewaltigen Plan, so wie jeden Morgen.
Das Planen des nächsten Tages ist eine erfreuliche Routine geworden und ein wichtiger Bestandteil des Abends. Zunächst schauen wir in die Karte und ziehen eine Linie zum nächstgrößeren Fixpunkt. Im Moment ist das Leipzig. Dann schauen wir, was es bereits an fertiger Infrastruktur gibt. Verläuft ein gut ausgeschilderter Radweg in der Nähe? Den nehmen wir doch gerne. Da müssen wir nicht soviel denken. Was aber, wenn der vorgefertigte Premiumweg einen riesigen Umweg macht, wie jetzt der Elberadweg, dem wir gerade folgten. Da fließt die Elbe in einem riesigen Bogen von Tangermünde nach Magdeburg und dann nach Dessau. Zu viel ist zu viel – da müssen wir querfeldein. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Wetter. Wie kalt, wie warm wird es sein? Haben wir viel Wind oder wenig und aus welcher Richtung kommt er? Gibt es Regen oder drohen Unwetter? Der dritte Punkt ist die Verfügbarkeit von preiswerten Pensionen auf dem Weg. Es ist gar nicht mehr leicht, eine Übernachtung für unter 50 Euro das Doppelzimmer zu bekommen. Dafür nehmen wir auch gerne mal 10 km mehr in Kauf.
Und irgendwann nach etwa einer Stunde ist die Route geplant und die Übernachtung gebucht.
Für heute war ein strammer Wind aus Südwest angesagt (für uns fast Gegenwind) und Unwettergefahr ab dem frühen Nachmittag. So brachen wir eine Stunde früher auf als sonst und hatten nur beschauliche 40 km vor uns.
Wir erreichten Burg gegen 14:00 Uhr und 10 Minuten nach unserer Ankunft schüttete es aus Eimern und der Donner grollte.
In der kleinen Pension angelangt, gelüstete es Martina nach einem heißen Tee. Zu diesem Zwecke installierte sie unseren Spirituskocher auf dem Zimmertisch. Beim Anzünden verbrannte sie sich die Fingerchen, zuckte zurück und brennendes Spiritus ergoss sich über den Tisch. Nach ihrem heftigen Hilferuf schmiss ich meine graue Jacke über das Flammenmeer, um es zu ersticken. Der Rauchmelder sprang gottlob nicht an und Verbrennungen gab es keine. Die Schäden am Tisch sind überschaubar, doch meine Jacke hat nun ein Brandloch am Rücken von ca. 15 x 15 cm.
Selbstverständlich habe ich über dieses Desaster – wie es meine Art ist – gegenüber Martina kein Wort verloren. Kein böser Blick geschweige denn der Anflug von Kritik. Aber ich ziehe die Jacke weiterhin an, auch in der Öffentlichkeit! Jawoll! Bis Martina mir irgendwann eine neue Jacke kauft. Die Kosten dafür stellen wir natürlich der Vermieterin in Rechnung.
Am Abend spazieren wir noch eine ganze Weile durch Burg. 22000 Einwohner und eine sehr wertvolle Bausubstanz. Viele Türme, zwei romanische Kirchen, ein eindrucksvolles Rathaus. Burg ist eine sehr alte Stadt und war einst wohlhabend. Nun ist der Lack ab. Das leicht Heruntergekommene, was ich in südeuropäischen Städten als pittoresk empfinde, scheint mir hier schäbig. Es fehlt wohl die Sonne. In der prachtvollen Einkaufsstraße ist jeder dritte Laden leer. Um mich zu trösten, frage ich zwei Passantinnen nach dem Weg zur „Katzentreppe“ und bekomme eine überaus freundliche Antwort. Ich bin versöhnt.

29.03.2023
3. Etappe
Von Seehausen nach Tangermünde

Heute morgen ist unser Wecker ein Presslufthammer. Im Schwimmbad wird gewerkelt und irgendwie mögen die Handwerker den „frühen Vogel“, der uns ein bisher unbekanntes Tier ist.
Nun gut, es ist 8 und da können wir auch raus. Einen Kaffee, noch einmal die Route anschauen, die wenigen Habseligkeiten zusammenraffen und los geht es. Wir sind wieder unterwegs.
Seehausen liegt abseits der Elbe und es dauert eine Weile, bis der große behäbige Fluss wieder in unser Blickfeld kommt. Wir radeln den Deich entlang. Es sind keine Menschen unterwegs. Die Elbauen schimmern in sattem Grün, ansonsten gibt es kaum Farben. Der silberne Wasserspiegel, ein dicker Wolkenteppich, der in vielen Grautönen changiert, und die immer noch schwarzen, blätterlosen Arme der Bäume, die sich silhouettenhaft vom Hintergrund abheben. Mitunter grüßt ein Kirchturm oder ein rotes Dach hinter dem Deich des anderen Elbufers. Etwas Melancholisches liegt in dieser Landschaft. Würde man jedoch dieses Bild mit Stille in Verbindung bringen, wäre das der falsche Schluss. Es zwitschert, es schnattert, es trompetet aus 1000 Kehlen. Ein Paradies für Vögel, wie es scheint.
Wir nähern uns der kleinsten Hansestadt Werben. Weshalb dieses Nest, mit nur 1000 Einwohnern eine Hansestadt ist, werden wir noch herausbekommen. Es ist halb zwölf. Zeit für ein Frühstück. Auf dem Markt ein Bäckerwagen und eine Bank. Robert erklärt der Bäckersfrau das Prinzip seiner Click-Brille. Die Dame ist begeistert. Das Fett der letzten Thüringer Wurst (von der Party) von den Lippen gewischt und weiter geht’s in Richtung Arneburg. In Arneburg besuchen wir die Touristeninformation. Wir trinken Kaffee in einer
Pizzeria und erfahren vom Wirt, einem waschechten Arneburger, etwas über das ehemalige Atomkraftwerk vor den Toren der Stadt. Dieses wurde in den 70er Jahren projektiert, in den 80er Jahren gebaut und in den 90er Jahren abgerissen, ohne je in Betrieb gewesen zu sein.
In Arneburg fällen wir noch eine andere, ganz grundsätzliche Entscheidung. Wenn wir den Weg wissen wollen oder eine Einkaufs- oder Einkehrmöglichkeit suchen – dann fragen wir ab sofort nicht mehr Google sondern die Einheimischen. Das macht viel mehr Spaß. Man lernt jedes mal einen freundlichen und hilfsbereiten Menschen kennen und das ist ein gutes Gefühl.
Weiter geht es nach Tangermünde und die nächste grundsätzliche Entscheidung steht nach wenigen Kilometern an. Wir stehen vor einem Wegweiser und grübeln. Nach links – Tangermünde 15 km auf dem Elberadweg, bekannterweise ein Premiumgenießerradweg. Nach rechts – Tangermünde 9 km. Wir sind doch nicht blöd und fahren 6 km mehr, deshalb nehmen wir selbstverständlich den kürzeren Weg. Nach wenigen Kilometern kennen wir die Wahrheit. Der direkte Weg führt an einem riesigen, qualmenden Fabrikmonster vorbei, in dem Zellulose produziert wird und Sattelschlepper im Minutentakt wahrscheinlich borkenkäferbefallene Bäume aus dem Harz heran karren.
Diese absurden Blüten der Zivilisation will dann doch niemand sehen. Wir sind froh, dass wir diesen direkten Weg gewählt haben.
In Tangermünde angekommen finden wir schnell unsere gebuchte Herberge. Diesmal in einem Fitnesscenter. Robert plant ein neues Buch mit dem Titel „180 Übernachtungen – 180 nächtliche Suchen nach dem Badlichtschalter“. Er glaubt, es wird ein Bestseller und der Erlös wird die Kosten der Reise locker finanzieren.

28.03.2023
2. Etappe
Von Ludwigslust nach Seehausen
Abfahrt nach dem Frühstück
Wir folgen zunächst der Hauptverkehrsstraße nach Grabow. Und tauchen dann nach Süden in die Prignitz ein. Wir fahren auf kleinen schmalen Sträßchen. Außer uns fährt da eigentlich niemand, abgesehen von den riesigen Traktoren, die in großen Abständen und ziemlich sportlich an uns vorbeidonnern. Ich springe jedes mal vorsorglich in den Straßengraben. Einige Traktoristen lachen und grüßen uns freundlich. Es ist wunderschönes Wetter. Kalt, kaum Wind und viel Sonne. Die Dörfer tragen merkwürdige Namen und sind allesamt ruhig und verträumt. Die Anzahl der Deutschlandfahnen in den Vorgärten ist verstörend hoch. Wir nähern uns der Elbe. Wir wollen mit der Fähre übersetzen von Lütkenwisch nach Schnackenburg. Gott sei Dank fährt sie wieder seit gestern. Der Pegelstand war zu hoch in den letzten Tagen. Wir bezahlen „zwei Euro für zwei alte Fahrräder und zwei Euro für zwei junge Leute“. Dem Fährmann sitzt der Schalk im Nacken. Wir sind bestimmt nicht die ersten, die diesen Spruch hören.
In den „Westen“ übergesetzt, empfängt uns die Geschichte der innerdeutschen Grenze, die an dieser Stelle verlief. Ein Museum, Gedenkstätte, Beschreibungen der Grenzanlagen, eine Tafel, klein beschrieben mit Namen von Menschen, die bei Fluchtversuchen ums Leben gekommen sind. Ein bitteres Gefühl macht sich breit.
Wir folgen nun dem Elberadweg. Und erreichen gegen halb fünf Seehausen.
Folgende Tiere trafen wir unterwegs:
Rehe, Störche, Kraniche, Gänse, drei Biber, eine Katze, einen Mäusebussard.
Robert behauptet, er habe am Ende noch zwei Pinguine gesehen. Ich zweifele das dezent an, lasse ihn aber in dem Glauben.
Unsere Unterkunft für heute – das Waldbad in Seehausen. Gebaut 1938. Ich habe noch nie in einem Schwimmbad geschlafen.

27.03.2023
1. Etappe
Von Schwerin nach Ludwigslust
Der Tag beginnt mit Geschäftigkeit. Diese übertönt angenehm den sich immer wieder aufdrängenden Gedanken: zum letzten Mal für lange Zeit. Die vertraute Umgebung, das gemütliche Bett, die liebgewonnenen Rituale beim Morgenkaffee.
Meine Güte, was alles noch zu erledigen ist an diesem Morgen. Gut, das unsere erste Etappe nur eine sehr kurze ist.
Unser Schlüssel bleibt im Laden. Und da Gitta und Jakob nicht da sind, ist die letzte Aktion, die Haustür hinter sich zuzuziehen. Dann gibt es kein Zurück. Alles, was noch drin ist im Laden, muss auch vorerst drin bleiben. Es ist zum Glück nicht meine Aufgabe. Robert zögert die Entscheidung auf groteske Art heraus. Haben wir die Kreditkarte, den Ausweis? Ist die Herdplatte aus und vielleicht wäre es überhaupt das Beste, die ganze Sache abzublasen und zu Hause zu bleiben. Nun Schluss – die Tür fällt ins Schloss, letzte Fotos von unserer Abreise macht Kerstin und los geht es.
Das Abenteuer beginnt.
Das Wetter ist zwar besser als angesagt, aber wir entscheiden uns trotzdem nicht für den schönsten, sondern für den kürzesten Weg, entlang der Bundesstraße. Wir radeln schweigend nebeneinander her, noch tief in Gedanken versunken. Die letzten Tage waren voll Abschied und sehr berührend. Manchmal holt uns ein warmer Sonnenstrahl, etwas frisches Grün oder der freundliche Ruf eines Vogels zurück. Schön ist es. Die Brummis auf der Straße neben uns stören weniger als gedacht. Nach 20 km überkommt Robert ein Blitzschmerz im Hinterteil. Wir brauchen eine Pause. Wir trinken einen Milchkaffee im Hof Denissen in Wöbelin. 4 Euro pro Stück in der Selbstbedienung. – Mist, wir wollten doch sparen. Von nun an wird es hoffentlich billiger. Wir steigen ab, im altehrwürdigen Hotel „Stadt Hamburg“. Der Empfangsbereich sieht aus wie vor hundert Jahren. Eine uralte Telefonzelle ist der Blickfang. Der Chef des Hauses ist ein 72jähriges Fossil, welcher uns am nächsten Morgen seine und die Lebensgeschichte seiner Urahnen erzählt. Unser schöner Plan war, mit Claudia einen Film im Kino „Luna“ zu schauen. Claudia steckte im montäglichen Streikchaos der Bahn. So mussten wir ohne sie gehen. War ein schöner Tagesabschluss.
Prolog
Sonntagabend 26.03. 20:00 Uhr. Der Tag vor unserer Abreise. Wir tun das, was wir gewöhnlich tun um diese Tageszeit. Sitzen zusammen, trinken ein Glas Wein, berichten uns über die Eindrücke des Tages und schmieden Pläne für die Zukunft. Heute sind wir ungewöhnlich still. Unsere abendlichen Gespräche hatten immer mehr an Fahrt aufgenommen in den letzten Wochen und Monaten. Was ist noch zu erledigen, worum müssen wir uns noch kümmern, was kann noch abgeschlossen werden vor unserer Abreise? Was wollen wir unbedingt mitnehmen, was brauchen wir vielleicht und was auf keinen Fall? Wir haben geträumt, haben die Tage gezählt, wurden immer ungeduldiger und mitunter erhitzten sich die Gemüter.
Nun sitzen wir hier und alles. was getan werden musste, ist getan. Zwei Jahre der Vorbereitung liegen hinter uns. Ungeduld ist nun nicht mehr vonnöten. Es kann losgehen und das macht uns sprachlos. Wir teilen uns eine Flasche Sekt – immerhin habe ich ja immer noch Geburtstag – und gehen früh schlafen.
Wanderung nach Pyrgos

30.12.2022
Von Grabow (Meckl.) nach Neustadt-Glewe
Um 8:00 Uhr klingelt der Wecker. Heute brechen wir auf, zu unserer Wanderung ins Neue Jahr. Ein heißer Kaffee, wenig Worte, wir schmieren uns Brote für unterwegs und befüllen die Thermoskanne mit heißem Tee.
Ich trage heute zum ersten Mal meine neuen Wanderschuhe. Ich schmiere sie dick mit Lederfett ein und hoffe das Beste. Neue Schuhe können zickig sein – wollen eingelaufen werden. Mal sehen. Unser Zug zuckelt nach Grabow. Spuckt uns aus in dieser Mecklenburger Kleinstadt gegen 11:00 Uhr. Wir waren noch nie hier. Was fällt uns ein zu Grabow? Zunächst nur Grabower (Schaum)Küsschen. Wir recherchieren: 5500 Einwohner, Stadt an der Elde, keine Kriegsschäden, ein Rathaus von 1792, ein jüdischer Friedhof mit Synagoge. Eine regionale Schule und eine Grundschule. Zwischen 1999 und 2005 wurden in Grabow drei Schulen geschlossen, darunter das Gymnasium.
Wir wandern los. Unser Weg folgt der Elde in nordöstlicher Richtung. Die Elde ist mit 208 km der längste Fluss Mecklenburgs. Er verbindet die Müritz mit der Elbe und mündet in Dömitz in diese. Schon im 14. Jahrhundert begannen Versuche den Fluss als Handelsweg auszubauen. Heute heißt er offiziell Müritz Elde Wasserstraße. Der Höhenunterschied von 45m zwischen Plau am See und Dömitz wird mit 17 Schleusen überbrückt. Wirtschaftlich ist er längst uninteressant geworden. Hauptsächlich Sportboote und Hobbyschiffer befahren diese Bundeswasserstraße.
Es ist eine wunderbare Wanderung. Nach tagelangem grau in grau und Regen, Regen, Regen scheint heute mal wieder die Sonne. Sie steigt kaum über den Horizont und alles schimmert in goldenem, matten Licht. Mecklenburger Melancholie habe ich diese Winterstimmung getauft. Wir erreichen die Hechtsforthschleuse und bewundern das verwunschene Kraftwerk. Es ist aus den 20er Jahren und steht unter Denkmalschutz. Kein Mensch weit und breit. Es ist 13:00 Uhr und Zeit für eine Mahlzeit. Wie wunderbar schmecken Leberwurstbrote und Schwarztee am Ufer des Flusses mit Sonne im Gesicht. Kein Hotelfrühstücksbuffet im 4 Sternehotel reicht da heran.
Wir wandern weiter, vorbei an alten Brücken, geheimnisvollen Trafohäuschen. Nun taucht zu unserer rechten Hand der Flugplatz von Neustadt Glewe auf. In den 30er Jahren aufgebaut als Fliegerhorst mit NS Fliegerschule, siedelte sich hier ein Nebenbetrieb der Norddeutschen Dornier-Werke Wismar an, in dem Flugzeugteile für Jagdflugzeuge hergestellt worden. Man errichtete an der Ostseite des Flugplatzes ein Konzentrationslager (ein Außenlager des KZ Ravensbrück) in dem 900 Frauen aus Polen und Belarus untergebracht waren, welche Zwangsarbeit in der Flugzeugproduktion leisten mussten. Ab Januar 1945 kamen hier Evakuierungstransporte aus östlich gelegenen Konzentrationslagern an. Bis zu 5000 Menschen hausten hier unter menschenunwürdigen Bedingungen.
Wir erreichen bei Sonnenuntergang, es ist jetzt 16:00 Uhr Neustadt Glewe und nehmen Quartier. Wir residieren im Neustädter Schloss. Ein barockes Bauwerk empfängt uns. Wir haben das preiswerteste Zimmer gewählt und sind folgerichtig in der Dienstbotenabteilung unterm Dach untergebracht. Es ist gemütlich und warm. Wir ziehen die Schuhe aus, legen uns auf die frisch bezogenen Betten. Ein Knick im Kopfkissen, ein Schokolädchen darauf drapiert. Zeit zum Ausruhen. Ich schaue die Fotos an und beginne die Erlebnisse des Tages aufzuschreiben. Fertig werde ich nicht. Es ist 18 Uhr und wir haben Knast. Wir suchen uns einen Tisch im Neustädter Istanbulgrill und bestellen uns einen Dönerteller komplett. Es duftet nach Fritierfett, das grelle Neonlicht ist authentisch. Während wir auf unser Essen warten beschäftigen wir uns mit der Geschichte von Neustadt Glewe. 7000 Menschen leben hier. Die Altstadt ist aus dem Mittelalter. Zentrum bilden die Burg, das Rathaus, das barocke Schloss und der alte Hafen. Irgendwann begann man mit der Verhüttung von Erzen. Die einst waldreiche Gegend wurde so zur Sumpf- und Wiesenlandschaft, die heute Lewitz heißt. Immer wieder brannte die Stadt ab. Eine Lederwarenindustrie entstand, die bis zum Ende der DDR hinterwäldlerisch und personalintensiv produzierte. Bis zu 1700 Menschen spazierten hier täglich durch das Fabriktor.
Wir haben aufgegessen und bezahlen. Robert gibt dem freundlichen Imbissbesitzer 50 Cent Trinkgeld. Respekt! Noch ein kleiner Abendspaziergang. Wir gehen in den Innenhof der Burg. Schauen durch kleine Fensterscheiben in ein gemütliche Restaurant, drehen eine Runde ums Rathaus. Schlendern durch eine dunkle, schmale Gasse zur Kirche, welche umsäumt ist von windschiefen Fachwerkhäuslein und öffnen wieder die schwere große Pforte des Schlosses. Das Hotel hat eine Sauna. Das ist kostenlos und da müssen wir hin. Die Sauna versteckt sich im Gewölbekeller. Es ist ganz ruhig hier. Wir sind die einzigen Gäste. Nun liegen wir wieder auf unseren Betten. Trinken ein Glas Wein und glotzen TV, die Titanic geht gerade unter. Der Plan für morgen steht. Wir können schlafen gehen.
Hiermit laden wir Sie herzlich ein zu einer Lesung. Wir räumen um, stellen Stühle, kaufen ein paar Getränke und begrüßen ganz herzlich Siegbert Schefke in unserem Antiquariat. Dieser wird aus seinem neuen Buch für uns lesen, welches wir Ihnen hier vorstellen:

Als die Angst die Seite wechselte - Die Macht der verbotenen Bilder
Ex-Bürgerrechtler Siegbert Schefke über die friedliche Revolution
Seine Bilder gingen um die Welt: Im Herbst 1989 trickst der DDR-Bürgerrechtler und Regimekritiker Siegbert Schefke gemeinsam mit dem Fotografen Aram Radomski die Stasi aus und filmt heimlich die Montagsdemonstrationen in Leipzig. Die Filme spielt der Mitbegründer der DDR-Umweltbibliothek westlichen Medien zu, so auch am 9. Oktober, als mehr als 70 000 Menschen durch Leipzig ziehen. Einen Tag später werden diese Bilder in den ARD-Tagesthemen ausgestrahlt. Damit sehen erstmals auch Millionen DDR-Bürger was in ihrem Land vor sich geht und was ihnen die SED-Führung unter Erich Honecker verheimlicht.
Nach der Wende wird Schefke für seinen Mut und seine Verdienste um die deutsche Einheit mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Bambi. Heute lebt und arbeitet der ursprünglich aus Brandenburg stammende Fernsehjournalist in Leipzig.
30 Jahre nach dem Mauerfall hat Siegbert Schefke nun seine Geschichte aufgeschrieben. In dem im Berliner Transit Verlag erschienenen, von Maren Martell herausgegebenen Buch "Als die Angst die Seite wechselte - Die Macht der verbotenen Bilder" schreibt er nicht nur über die spannenden Ereignisse im Herbst 1989. Er erzählt auch wie aus einem Eberswalder Maurersohn ein dezidierter Kritiker des DDR-Regimes wurde, der nicht mehr auf eine Reform der DDR hoffte, sondern einen radikalen demokratischen Umbruch wollte und diesen mit sehr riskanten Aktionen mit in die Wege leitete. Siegbert Schefke: "Niemals wieder möchte ich von einem Staat gezwungen werden, mich vollkommener Presse-, Reise- und Meinungskontrolle unterwerfen zu müssen. Damit stempelt er nicht nur die Bürger unmündig, sondern schränkt sie in ihrer persönlichen Entwicklung und Freiheit massiv ein." Siegberts Schefkes Blick richtet sich aber auch auf die Nachwendezeit bis Heute. Für den MDR berichtet er über die Pegida- und Legida-Demonstrationen sowie die Aufmärsche in Chemnitz. In seinem Buch zieht er Schlüsse und wirft Fragen auf. "Mich beschäftigt die Frage: Haben im Osten unseres Landes zu viele die Demokratie nie gelernt oder begriffen? Klar waren nicht alle `Rechte`und auch nicht Nazis, sagten Tage später einige Chemitzer. Aber welcher einigermaßen klar denkender Mensch steht länger als eine Sekunde neben einem, der den Arm zum Hitlergruß hebt? "
Siegberts Schefkes Buch enthält viele Fotos aus der Wende-Zeit und davor sowie Auszüge seiner Stasi-Akte und anderen DDR-Dokumenten. Über QR-Codes kann man Filme über ihn sowie die Original-Filmaufnahmen der Leipziger Montagsdemo abrufen.
Siegbert Schefke, "Als die Angst die Seite wechselte - Die Macht der verbotenen Bilder", Herausgeberin Maren Martell, Transit Verlag Berlin, 160 Seiten, ISBN 978-3-88747-373-0 www.transit-verlag.de
Auch die Schweriner Volkszeitung hat sich diesem Thema angenommen:


10.05.2019
Na endlich! Der Wahlkampf tobt und wir als kleine Antiquare und Geigenlehrer wissen gar nicht so richtig, was und wen
wir wählen sollen, welche Partei sich für unsere Interessen einsetzen möchte. Da kommt uns doch die Plakatierung der CDU gerade recht. Was für eine Freude, diese Partei baut ja erwartungsgemäß
auf Polizisten, Sportler, Rechtsanwälte, Ärzte und alle möglichen und unmöglichen Berufsgruppen, sogar auf das Volk baut sie. Nun baut sie vor lauter Verzweifelung auch noch auf uns Antiquare und
selbst Geigenlehrerinnen werden bemüht. Wir werden natürlich dieses Vertrauen nicht enttäuschen … Oder hat sich da etwa jemand beim Plakatekleben einen kleinen, feinen Scherz erlaubt ...
??


09.01.2019
Liebes kunstsinniges Publikum:
Neulich des Nachts wurde unser Laden durch ein kleines Kunstwerk verziert. Leider hinterließ der Schöpfer (nicht alle sind eitel und ruhmsüchtig) weder seinen Namen noch den Titel seines Werkes. Wir haben es beschriftet, mit einem Rahmen versehen und „Schelfstadtschnecke“ genannt. Warum? Weil wir in der Schweriner Schelfstadt wohnen und weil das Ding wie eine Schnecke aussieht. Oder haben Sie einen besseren Vorschlag?
30.05.2018
Liebe Leute, in Kürze wird es eine neue Rubrik auf unserer Homepage geben: „Musikzimmer“. Seit einiger Zeit gibt Martina Geigenunterricht, immerhin ist sie ausgebildete Musikpädagogin. Einige Schüler hat sie schon gefunden, aber es könnten noch mehr werden. Deshalb gibt es auch etwas Werbung und wer in Schwerin und Umgebung Menschen mit Lust auf Geigenunterricht kennt, möge diesen Tipp weitergeben.

11.12.2017
Weihnachtszeit – schönste Zeit. Der nette Laden an der Ecke eignet sich wunderbar für Postdienste aller Art: DPD, Hermes, UPS und auch die liebe DHL liefern Pakete und Päckchen aller Art und finden am Vormittag natürlich unter der werktätigen Bevölkerung keinen Empfänger. Also ab mit dem Kram zum Altpapierhändler: “Können Sie bitte eine Kleinigkeit für Ihre Nachbarn annehmen?“ Der gutmütige Antiquar nickt und schon häufen sich die Stapel. Gut, einen Vorteil gibt es: Der nette DHLer nimmt auch unsere Büchersendungen mit. Und da wird nicht geguckt, ob die Dinger mit Klammern postvorschriftsmäßig gepackt sind, damit jeder neugierige Postbeamte seinen Rüssel zwecks Prüfung hinein stecken kann. Wäre ja auch ganz wichtig, denn Buchantiquare versenden möglicherweise Anglerbedarf zum Büchersendungstarif.
Zurück in den vollgepackten Laden: Die erste Notbremse haben wir gezogen. Für die Nachbarn werden nach wie Geburtstagspäckchen und ähnliches angenommen, aber keine Sendungen von AMAZON. Unser Buchbestand ist nicht bei Amazon gelistet und wir beziehen nichts über diese Bande. Warum sollten wir dieses fragwürdige Geschäftsmodell unterstützen? An der Ladentür steht jetzt „Amazonfreie Zone“ und der Berg der angenommenen Lieferungen hat sich ein wenig verkleinert. Aber H&M, Zalando und Otto holen mittlerweile auf. Doch selbst wenn wir die Annahme auch dieser Massenware verweigern, steht doch der Hermesbote in der Tür und fragt:“ Herr Loest, können Sie bitte für Müllers die Sesselgarnitur annehmen?“
08.11.2017
Es ist soweit: Am 11.11.2017 findet zum 14. Mal in Schwerin die Veranstaltung „Eine Straße liest“ statt. Ursprünglich auf die Münzstraße begrenzt, weitet sich dieser Lesemarathon auf die Innenstadt aus. Erstmalig ist auch das Antiquariat R. Loest in der Körnerstraße dabei, ein Fliegenschiss von der Münzstraße entfernt. Aus seinem Werk „Prinz Schnaps“ wird der Leiter des Stadtarchives Dr. Bernd Kasten lesen. Es geht um die schwarzen Schafe im mecklenburgischen Fürstenhaus. Also die Trunkenbolte, Geldverschwender, Schwerenöter und Dummköpfe, die hier im Schweriner Schloss oder in Ludwigslust residiert haben. Beginn ist 18:00 Uhr, der Eintritt ist frei, aber eine Spende für UNICEF wird erwartet. Seien Sie uns herzlich willkommen. Martina Weidner und Robert Loest

14.09.2017
Wahlkampf im Antiquariat: Während die steuerfinanzierten Parteien mit ihren unsäglich platten Hochglanzplakaten die Straßen und Plätze verschandeln, hängt in unserem Schaufenster ein Plakat besonderer Art. „Wählt die PFGFIDSDG“, die Partei für gemäßigten Fortschritt in den Schranken der Gesetze.
Diese Partei hat kein geringerer als Jaroslav Hašek ins Leben gerufen, der Vater des braven Soldaten Schwejk. Als Ulkpartei nahm sie vor dem ersten Weltkrieg die damaligen Wahlen auf die Schippe. Es gab ein hübsches Programm (s. unten), eine Hymne und wie es sich für eine ordentliche Partei gehört, auch einen Schlachtruf.
Schlachtruf der Partei wurde das Kürzel „SRK“, was offiziell für „Solidarität, Recht und Kameradschaft“ stand, in der Parteipraxis aber Sliwowitz, Rum und Kontuschowka (Kräuerschnaps) bedeutete.
Das Wahlprogramm des Kandidaten für den Wahlbezirk Weinberge, Jaroslav Hašek, umfasste sieben Punkte:
1. Die Wiedereinführung der Sklaverei.
2. Verstaatlichung der Hausmeister („auf die gleiche Weise wie in Rußland [..], wo jeder Hausmeister gleichzeitig ein Polizeispitzel ist“).
3. Die Rehabilitierung der Tiere.
4. Die Einrichtung von staatlichen Anstalten für schwachsinnige Abgeordnete.
5. Die Wiedereinführung der Inquisition.
6. Die Unantastbarkeit der Geistlichen und der Kirche („Falls ein Schulmädchen von einem Geistlichen defloriert wird“).
7. Die obligatorische Einführung des Alkoholismus.
Das Antiquariat Loest schließt sich den Forderungen der PFGFIDSDG mit geringen Einschränkungen an und fordert die Subventionierung aller Buchantiquariate, besonders die in Schwerin ansässigen. Wir werden die Neugründung der Partei beschleunigen und zur kommenden Bundestagswahl antreten. Ihre Stimmen sind erwünscht, als Geschenk erhalten Sie - wie damals - ein Taschenaquarium.
18.05.2017
Eine ältere Frau kommt hereingeschneit. Mehrere Ordner mit Filmprogrammen, teilweise Vorkrieg, ansonsten aus Deutschland Ost und West. "Herr Loest, ich habe keine Verwendung mehr dafür, wollen Sie die geschenkt haben?" "Naja", sagt der Antiquar gönnerich, "für den Müll sind sie wirklich zu schade, stellen Sie mal hin." Die Dame geht buchstäblich erleichtert von Dannen und der neugierige Altpapierhändler betrachtet sich das Geschenk. Von James Bond bis Claudia Cardinale, Gojko Mitic und ganz ganz viele andere Berühmtheiten. Dazu Bilder von Schauspielern samt Autogramm - eben alles, worin eine Sammlerin ihr Herzblut fließen läßt. - Da freut sich der Antiquar und gelobt, bei einem Wiedersehen die gute Frau mit einem netten Krimi oder Fortsetzungsromanen zu beglücken.
Heute war sie wieder da und ich sprang schon auf, um die bereitgestellten Bücher zu holen. Aber sie meinte nur: Na, hat sich schon jemand für die Programme interessiert? Nö, meinte ich, bisher noch nicht. - "Ach", sprach sie, "da nehme ich sie wieder mit. Ich werde es mal auf dem Flohmarkt damit probieren. Vielleicht kommt da noch was rum". Mit einem tränenden Auge ließ ich sie samt Mappen ziehen. Aber wann ist eigentlich der nächst Flohmarkt?

03.05.2017
Kommt heute ein Kunde in den Laden und möchte etwas von H. Böll. Und zwar "Die verlorene Ehre der Katharina Blum". Ja, gesehen hatte er neulich diesen Film im "Kino Unterm Dach" in Schwerin und wollte nun mal wissen ...
Aber ja, das Buch haben wir und hatten auch einen Newsletter zu diesem Film - für unser Kino - geschrieben. Newsletter?? So sieht ein NL zum Film aus:
Sehr geehrte Newsletter-Empfänger,
was verstehen Sie unter dem Wort MORAL?Eilen sie nicht zur Wikipedia, dies habe ich Ihnen bereits abgenommen und zitiere folgendes: „Moral…ein Regel- und Wertesystem, welches gewachsen ist aus kulturellen und religiösen Erfahrungen“ . Klingt gut, klingt versöhnlich, aber kennen Sie die abgedroschene Phrase: “Moral regelt das Zusammenleben der Menschen, würden wir uns doch ohne dieses die Köpfe einschlagen, uns beklauen, es gäbe Mord und Totschlag, ein Hauen und Stechen“. Sagt MAN. Sagt wer?
Ich stelle diese Behauptung immer wieder in Frage. Warum passieren Veränderungen überkommener Moralvorstellungen meist schmerzhaft und unter Aufbegehren? Warum bedarf es dafür Revolutionen, Revolten? Wer klammert da an alten Zöpfen und ist nicht bereit, etwas abzugeben oder gar zu verändern? Wer bestimmt die Werte, schreibt die Regeln?
Moral als Machtinstrument , um all die, die nicht im Gleichschritt marschieren abzustrafen, anzuprangern und um damit letztendlich Überlegenheit zu demonstrieren?
Wohl dem, der auf der „richtigen“ Seite lebt. Katharina Blum tut es nicht, aber ich will nicht vorgreifen, sondern hier nur kurz die Szene beschreiben.
Die BRD in den 70er Jahren. Die facettenreiche 68er Studentenrevolte mäandert sich nur zäh in das Bewusstsein des gutbürgerlich, satten Wirtschaftswunderdurchschnittsmenschen. Der Zorn über die Diktatur des Kapitals, Seilschaften des Dritten Reiches und ungesühnte Verbrechen der Nazizeit brodelt im Untergrund, aggressiv und hilflos. Ende Juni 1972, zwei Jahre nach ihrer ersten Aktion, saß bereits die gesamte Führungsriege der ersten RAF-Generation im Stammheimer Knast.
Zurück zu Katharina B.: Sie sitzt auf dem Karussell der morbiden Gesellschaft und es rotiert unaufhaltsam. Wer hetzt auf, manipuliert, schürt Hass, hält die Kacke am Dampfen? Wer ist das Bindeglied zwischen dem nach Sensation gierenden und vor Genugtuung triefenden Pöbel und dem Staat mit seinen marionettesken Schergen und einflussreichen Lenkern im Hintergrund? Schlüsselfigur des Geschehens ist „DIE ZEITUNG“ und hier gilt: „Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der >BILD<-Zeitung ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich.“
Bleibt die Frage nach der MORAL von der Geschicht´. Für mich verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse. Aus Opfern werden Täter und diese zu Opfern. Nach welchen moralischen Maßstäben bewerte ich die Tat einer Verzweifelten?
Seien Sie uns herzlich willkommen, sagt die Verfasserin dieses Newsletters, die sich sehr auf den Film freut. Auch deswegen, weil wieder mal auf prähistorische Art Kino zelebriert wird. „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ auf Zellluloid! Ein fossiler Filmprojektor aus den tiefen 70ern wurde aktiviert, inklusive Dompteur Uwe. Er schnauft ein wenig (der Projektor) und knattert gemütlich vor sich hin. Erinnern Sie sich an dieses anheimelnde Geräusch?
Leiten Sie diesen Newsletter weiter an alle, die sich für politische und gesellschaftliche Themen interessieren. An die, die schon einmal ordentlich an den Kanten der Gesellschaft angeeckt sind und an all die, die sich dies nie trauen würden. An die, die hinter den Gardinen lunsen und ihr Hirn am Zeitungskiosk abgegeben haben und an all die, die nicht müder werden sich über derartige Zeitgenossen aufzuregen.
PS.: Etwas, was ich Ihnen nicht vorenthalten wollte: Manchmal sagt ein Bild mehr als hundert schöne Worte. Nämlich dann, wenn es gelingt einen oder mehrere Gedanken
auf den Punkt zu bringen.

































































































































































